Eishockey Grundkurs
( Quelle: Sportlexikon )
Eishockey und die Regeln und Begriffe
Eine der schnellsten Mannschaftssportarten
Eishockey entstand bereits Mitte des 19. Jahrhunderts und ist eine Sportart, die auf der Eisfläche ausgetragen wird, wobei fast durchwegs Eishallen verwendet werden, nur gelegentlich versucht man die Spiele unter freiem Himmel für großes Publikum zu organisieren. Dabei treten zwei Mannschaften gegeneinander an, um den Sieger zu ermitteln.
Grundlagen im Eishockeysport
Die Mannschaften haben auf jeden Fall 20 Spieler und sechs davon - Torhüter plus fünf Feldspieler - sind am Eis im Einsatz, um gegen die andere Mannschaft zu kämpfen. Als Spielgegenstand dient eine Gummischeibe, Puck bezeichnet. Ziel ist es, der gegnerischen Mannschaft möglichst viele Tore zu schießen oder zumindest eines mehr als diese erzielen kann.
Das Spiel ist sehr intensiv und daher gibt es beim Eishockey ständige Wechsel der Spieler. Manchmal werden nur einzelne Spieler ausgetauscht, häufig aber ganze Blöcke. Nur der Torhüter bleibt der gleiche, wobei auch dieser ausgetauscht werden kann. Das passiert beim Eishockey weit öfter als zum Beispiel beim Fußballspiel, weil ein Torhüter auch frustriert selbst aufgibt, wenn er schnell viele Tore kassiert hatte.
Erklären muss man den Block, der hier schon angeführt wurde. Die Spieler sind in zwei Verteidiger und drei Angreifer untergliedert, wobei jeder Spieler ähnlich dem Handballspiel schnell einmal ein Angreifer und auch wieder ein Verteidiger sein kann, da sich das Spiel rasch von einer Seite auf die andere verlagert. Die beiden Verteidiger bilden eine Linie (Verteidigungslinie), die drei Angreifer auch (Angriffslinie). Es spielen also die Spieler meist in der gleichen Struktur zusammen und kennen so ihre Laufwege. Verteidiger und Angreifer zusammen ergeben einen Block. Wird also der gesamte Block ausgetauscht, dann gehen alle fünf Feldspieler vom Eis und werden entsprechend ersetzt, man spricht auch von der Linie. Die 1. Linie enthält die besten Spieler, die 3. oder falls vorhanden 4. Linie die jüngeren und nicht so erfahrenen oder erfolgreichen Spieler.
Sehr schneller Sport ohne unentschieden
Eishockey ist die wohl schnellste Mannschaftssportart und ist sehr körperbetont. Es gibt viele Körperkontakte und diese sind auch erlaubt, aber es gibt ein Regelbuch, um Verletzungen zu vermeiden. Die Eisfläche ist durch eine ovale Abgrenzung, Bande bezeichnet, abgegrenzt, die neben dem unteren Aufbau eine Plexiglasscheibe aufweist, sodass das Publikum nicht getroffen werden kann und das ist ratsam, weil der Puck teilweise mit 130 km/h und mehr von A nach B befördert wird. Dies erfolgt mit dem Eishockeyschläger, den jeder Spieler nutzt - auch der Torhüter.
Dieser ist besonders ausgestattet, weil er Ziel der scharfen Geschosse der gegnerischen Spieler ist. Das heißt, eigentlich ist das Tor hinter dem Torhüter das Ziel, aber der Goalie, wie er auch bezeichnet wird, wirft sich natürlich mutig in die Schusslinie, um die Torerfolge zu vermeiden. Dabei ist der Kollege oft ein großer, das Tor dahinter selbst aber sehr klein, wenn man an das Tor auf dem Fußballplatz zum Vergleich denkt. Allerdings ist der Puck auch sehr klein und damit nicht so leicht zu fangen, wenn er mit hoher Geschwindigkeit herangeflogen kommt und damit stimmt die Relation wieder.
Eishockey hat einige Besonderheiten und dazu zählt zum Beispiel, dass es kein Unentschieden gibt. Egal ob in der nationalen Meisterschaft oder in internationalen Turnieren - wenn es nach 3 x 20 Minuten 2:2 steht, gibt es eine Verlängerung und der spätere Verlierer hat auf jeden Fall auch einen Punkt erworben. Das gibt es etwa im Fußball nicht. Reicht die Verlängerung nicht aus, dann erfolgt das Penaltyschießen, bis es einen Sieger gibt.
Regeln & Begriffe im Eishockeysport
Eishockey ist eine Weltsportart, die vom November bis sogar in den Mai hinein weltweit für Begeisterung sorgt. Im Mai sind noch die Finalspiele der NHL angesetzt und natürlich die Eishockey-WM der höchsten Spielklasse. Daher gibt es auch sehr viele Begriffe rund um das Spiel und den Sport.
Eishockey-Spielfeld
Eishockey-spielfeld und seine Dimensionen
Eisfläche mit drei Zonen
Die Grundlage des Eishockeyspiels ist meist eine Eishalle, in der die eigentliche Spielfläche aufgebaut wurde. Es gibt auch manchmal besondere Spiele, die unter freiem Himmel mit großem Publikum veranstaltet werden, aber das ist die Ausnahme und hat eher Showcharakter. Am Beginn einer neuen NHL-Saison wird das gerne angeboten, auch in Österreich hat es schon unter freiem Himmel die Spiele gegeben. Aber selbst dann ist die Spielfläche die gleiche wie in der Halle.
Was beinhaltet das Spielfeld im Eishockey?
Das Spielfeld für ein Eishockeyspiel ist eine rechteckige Eisfläche mit abgerundeten Ecken, die durch die Bande begrenzt wird, auf der eine Plexiglasscheibe montiert ist. Damit soll sichergestellt werden, dass das Publikum von der Gummischeibe - dem Puck - nicht getroffen wird und das ist gut so, denn der Puck ist zum Teil mit weit mehr als 100 km/h Geschwindigkeit unterwegs.
Typisch für das Spielfeld im Eishockey sind zwei Faktoren: zum einen die Unterteilung in Drittel und zum anderen die Tatsache, dass man auch hinter dem Tor spielen kann, denn das Tor ist nicht der seitliche Abschluss des Spielfeldes, wie man dies vom Fußballfeld oder auch aus dem Handballsport und Basketballsport her kennt. Außerdem gibt es Linien wie die blaue Linie, die die Drittel begrenzen und für den Spielverlauf wesentlich sind.
Auf der Eisfläche finden sich weitere für das Eishockeyspiel wesentliche Merkmale wie die Anspielkreise, deren es fünf Stück gibt. Diese dienen für das Bully, um die nächste Aktion beginnen zu können, nachdem das Spiel unterbrochen worden war. Auch der Torraum ist wesentlich, der sich direkt vor dem Tor befindet.
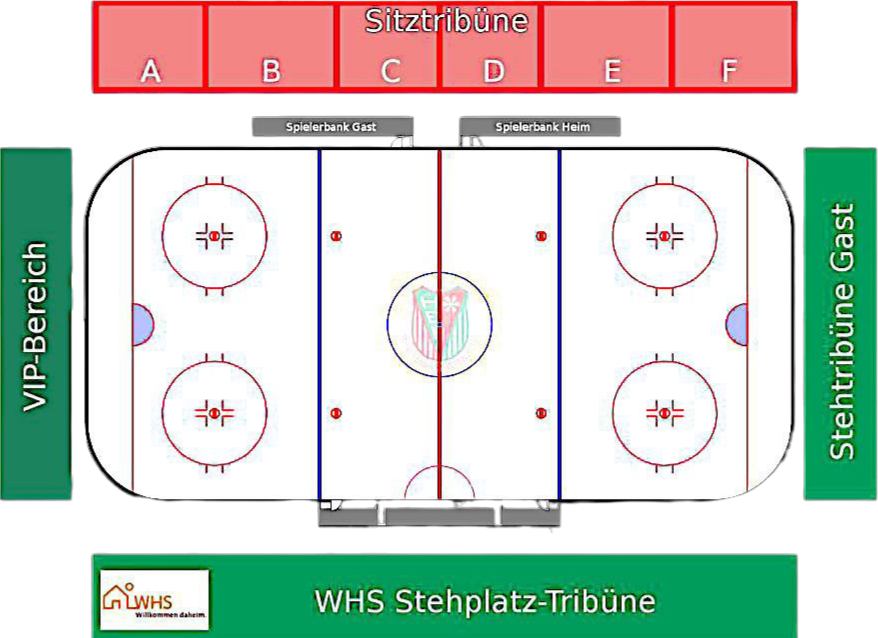
Dimensionen des Spielfelds
Interessant ist die Dimension des Spielfelds, denn die berühmte NHL, die National Hockey League mit kanadischen und US-amerikanischen Vereinen, spielt auf einem schmäleren Feld als üblich. Normalerweise ist das Spielfeld zwischen 56 und 61 Meter lang und 30 Meter breit. Die NHL spielt aber auf einem 26 Meter breiten Feld, wodurch weniger Platz für die Spielzüge zur Verfügung steht, dafür ist das Spiel noch körperbetonter. Das ist auch der Grund, warum Spieler aus Kanada sich immer umstellen müssen, wenn sie bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen, da das Feld eine andere und damit ungewohnte Dimension aufweist.
Bedeutung des Spielfelds
Das Spielfeld mit seinen Linien gibt viele Möglichkeiten vor und ist Grundlage zahlreicher Ausdrücke. Die neutrale Zone ist etwa in der Mitte zu finden, weil hier wird nicht unmittelbar ein Angriff durchgeführt, es ist auch keine Verteidigungszone. Die Zone beim Tor des Teams A ist aus Sicht dieses Teams die Verteidigungszone, denn hier kann Team B versuchen, ein Tor zu erzielen und umgekehrt ist die Zone beim Tor von Team B aus Sicht von Team A die Angriffszone, weil man hier selbst ein Tor schießen möchte.
Auch das Abseits hat mit den Linien zu tun und die Wiederaufnahme jedes Spielzugs erfolgt über das Bully an den vorgesehenen Stellen. Angriffs- und Verteidigungszone haben jeweils zwei Kreise vorgesehen, wo das Bully durchgeführt werden kann und darf und in der Mitte gibt es eine weitere Position.
Begriffe zum Spielfeld
Die Gliederung und die Spielweise führte zu bekannte Begriffe, wie sie oben auch schon angesprochen wurde.
Linien und Zonen
- rote Linie
- blaue Linie
- Verteidigungsdrittel
- neutrale Zone
- Angriffsdrittel
Tor und Torbereich
- Tor
- Torlinie
- Torraum
- Trapezoid: Bereich hinter dem Tor
- Wayne´s Office: Raum hinter dem Tor, benannt nach Wayne Gretzky, der von dort aus viele Angriffe gestartet hatte
Allgemein
- Anspielkreise
- Bande
- long change: Wechsel mit längerer Zufahrt zur Spielerbank (im 2. Drittel)
Begriffe zum Spielfeld im Eishockey
Rote und blaue Linie (teilen das Spielfeld ein)
Beschreibung:
rote Linie und blaue Linie
Verteidigungsdrittel (vor dem eigenen Tor)
Beschreibung: Verteidigungsdrittel
Angriffsdrittel (beim gegnerischen Tor)
Beschreibung: Angriffsdrittel
Neutrale Zone (Spielmitte)
Beschreibung: Neutrale Zone
Tor mit Torraum (sowie Torlinie)
Beschreibung:
Tor sowie Torraum und Torlinie
Bande (grenzt Spielfeld ab)
Beschreibung: Bande
Anspielkreise (für das Bully)
Beschreibung: Anspielkreise
Rote & Blaue Linie
Rote linie auf dem Eishockeyspielfeld
Trennung der Spielhälften
Das Spielfeld im Eishockeysport wird durch verschiedene Linien gekennzeichnet und auch unterteilt. Sehr häufig wird die blaue Linie genannt, die es zweimal gibt und das Spielfeld in drei Drittel unterteilt, was für die Spielregeln und auch für die Taktik sehr wichtig ist, aber es gibt noch mehr wichtige Markierungen.
Welche Funktion hat die Rote linie im Eishockey
Auf dem Spielfeld gibt es neben den blauen Linien auch die rote Linie, die sich exakt in der Mitte des Spielfeldes befindet und die Eisfläche in zwei Hälften unterteilt. Auf der roten Linie befindet sich ein Anspielpunkt, der dann zum Tragen kommt, wenn entweder ein Drittel begonnen wird oder wenn gerade ein Tor erzielt wurde. Dann wird an diesem Punkt ein Bully ausgeführt, um das Spiel zu beginnen bzw. fortzusetzen.
Um diesen Anspielpunkt herum gibt es den Anspielkreis wie bei den anderen vier Anspielpunkten auf der Eisfläche auch. Diese Markierungen dienen für die Ausführung des Bullys und spielen daher auch beim Anspiel an der roten Linie eine Rolle, um das Spiel entsprechend fortsetzen zu können.
Die rote Linie ist vor allem dafür verantwortlich, dass sich die Mannschaften auf ihrer Spielhälfte befinden, wenn ein Bully in der Mitte stattfindet. Das Bully kann auch in die Mitte des Spielfeldes verlegt werden, wenn es eine Abseitsentscheidung gab oder das Spiel auf andere Weise unterbrochen wurde und ein Bully in einer Verteidigungszone nicht vorgesehen ist.
Außerdem stellt die rote Linie von den Markierungen her das Zentrum der neutralen Zone dar, also jener Zone, in der der Spielaufbau stattfindet. Sie dient als Übergang von der Verteidigungszone zur Angriffszone und Abspielfehler in der neutralen Zone, oft auf Höhe der roten Linie, sorgen im Eishockey häufig für schnelle Konter und Gefahr für das eigene Tor
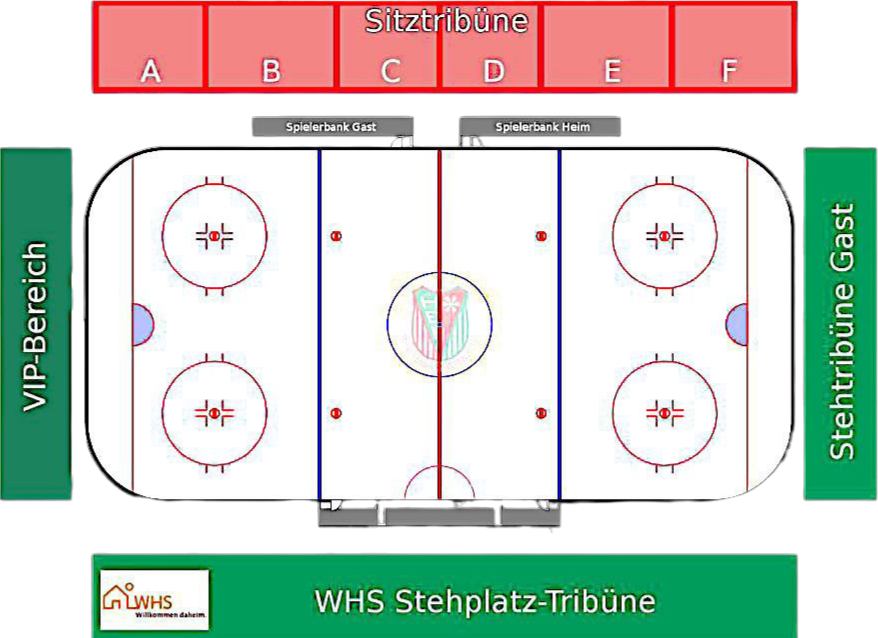
Bedeutung der roten Linie
Es hat einen guten Grund, warum Laien die blaue Linie vom Eishockeyspiel auch kennen, aber mit der roten Linie nicht viel anfangen können. Denn diese spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn es ein Bully in der Mitte gibt. Für den unmittelbaren Angriff oder andere Aktionen im Spiel spielt die Linie keine große Rolle. Sie ist nach dem Torerfolg zum Trennen der Mannschaften in ihre Hälften ein Thema, aber wenn der Puck wieder im Spiel ist, ist sie nicht so wichtig.
Blaue linie am Eishockeyspielfeld
Unterteilung des Spielfelds in Drittel
Auf dem Spielfeld im Eishockey finden sich insgesamt zwei blaue Linien, die deutlich zu sehen sind. Sie haben zwei unterschiedliche Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin, dass die Eisfläche in Drittel untergliedert wird, die zweite hat für die Spielsituationen große Relevanz.
Welche Funktion hat die Blaue linie im Eishockey
Durch die blauen Linien wird aus Sicht eines der teilnehmenden Teams die Spielfläche zu einer Fläche mit drei Zonen: dem Verteidigungsdrittel (oder Verteidigungszone), der neutralen Zone sowie dem Angriffsdrittel (oder Angriffszone). Während im Verteidigungsdrittel der Auftrag besteht, gegnerische Tore zu verhindern, ist das Angriffsdrittel jener Abschnitt der Eisfläche, wo man selbst versucht, dem Gegner ein Tor zu schießen. Die neutrale Zone ist der Puffer dazwischen, um Spielzüge zu unterbinden oder selbst Angriffe einzuleiten.
Die zweite Aufgabe der blauen Linie ist für die Beurteilung der Spielsituationen wichtig. Wie im Fußball gibt es auch im Eishockey ein Abseits, aber jenes ist einfacher konzipiert. Es darf der Puck nur in das Angriffsdrittel gebracht werden, wenn noch kein eigener Spieler sich dort aufhält. Wenn nun ein Mitspieler aus der eigenen Mannschaft schon im Angriffsdrittel ist, wird das Spiel unterbrochen, wenn man mit dem Puck hineinfährt. Daher ist oft zu beobachten, dass ein Angreifer erst das Angriffsdrittel verlässt, ehe ein anderer den Puck hineinspielt und einen Angriff versucht. Aktives oder passives Abseits gibt es hier nicht.
Und noch eine Rolle spielt die blaue Linie: wenn ein Spieler auf die Strafbank geschickt wird, kann die gegnerische Mannschaft ein Power Play aufziehen. Das bedeutet, dass alle Spieler einer Mannschaft im Angriffsdrittel sind und ihre Überzahl ausnutzen wollen. Gelingt es jetzt der verteidigenden Mannschaft, den Puck aus dem Drittel und damit über die blaue Linie zu spielen, dann müssen alle Angreifer das Drittel verlassen und einen neuen Angriff aufbauen.
In dem Zusammenhang ist wichtig zu verstehen, dass man auch auf das gegnerische Tor nur schießen darf, wenn man sich im Angriffsdrittel befindet. Wenn der Puck auf der Linie liegt, ist er im Angriffsdrittel, ist er außerhalb, dann darf nicht auf das Tor geschossen werden.
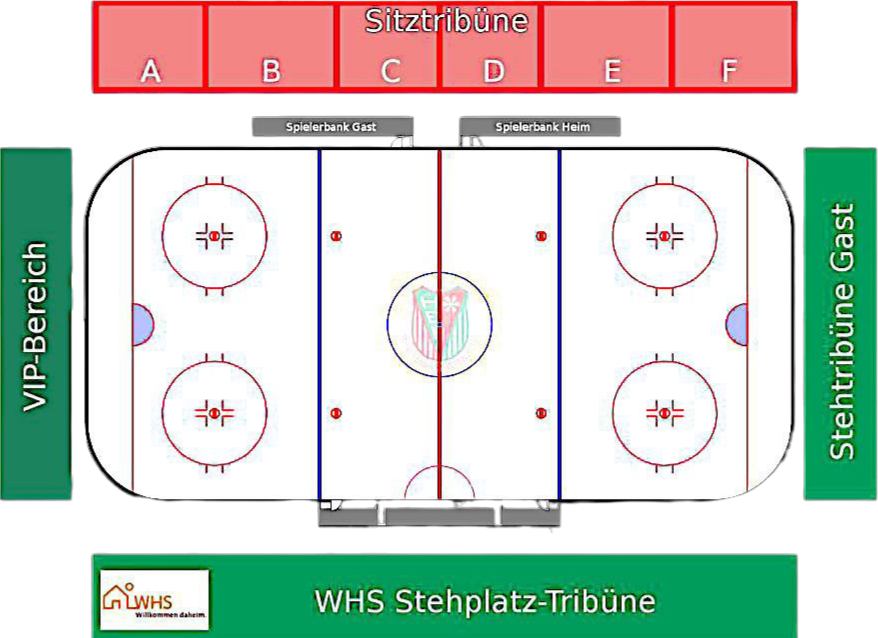
Schüsse von der Blauen Linie
Unterteilung des Spielfelds in Drittel
Auf dem Spielfeld im Eishockey finden sich insgesamt zwei blaue Linien, die deutlich zu sehen sind. Sie haben zwei unterschiedliche Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin, dass die Eisfläche in Drittel untergliedert wird, die zweite hat für die Spielsituationen große Relevanz.
Verteidigungs- & Angriffsdrittel
Verteidigungsdrittel auf dem Eishockeyspielfeld
Im Verteidigungsdrittel gibt es eigentlich nur eine Strategie: weg mit dem Puck! Aber das ist so natürlich nicht ganz richtig, denn die eigenen Angriffe beginnen oft im eigenen Abwehrbereich, wobei mit einem langen Pass die Angreifer umgehend ins Spiel gebracht werden können und ein Gegenangriff in Form eines Konters erfolgen kann. So kann aus einer gefährlichen Situation durch den Gegner eine gefährliche Situation für den Gegner werden.
Welche Bedeutung hat das Verteidigungsdrittel?
Im Verteidigungsdrittel gibt es eigentlich nur eine Strategie: weg mit dem Puck! Aber das ist so natürlich nicht ganz richtig, denn die eigenen Angriffe beginnen oft im eigenen Abwehrbereich, wobei mit einem langen Pass die Angreifer umgehend ins Spiel gebracht werden können und ein Gegenangriff in Form eines Konters erfolgen kann. So kann aus einer gefährlichen Situation durch den Gegner eine gefährliche Situation für den Gegner werden.
Das Problem des Verteidigungsdrittels ist die Tatsache, dass ein Abspielfehler schnell zu einem unnötigen Gegentor führen kann. Wenn man nicht vorsichtig ist, lädt man die gegnerischen Stürmer geradezu dazu ein, sich den Puck zu schnappen und einen Torschuss zu wagen. Daher ist hier große Vorsicht angesagt, weil auch die Abseitsfalle nicht funktionieren kann, wenn der Puck schon im Drittel gespielt wird. Ein Abspielfehler ist also als verteidigende Mannschaft gar keine gute Idee.
Im Verteidigungsdrittel findet sich das eigene Tor und auch zwei Anspielkreise mit den entsprechenden Markierungen, die für das Bully genutzt werden. Sie befinden sich links und rechts vom Tor aus gesehen und dienen dazu, das Spiel fortsetzen zu können.
Die blaue Linie wiederum stellt die Abgrenzung zur neutralen Zone dar, also zum nächsten Drittel des Spielfeldes und die Verteidigungsarbeit beginnt bereits bei dieser Linie, um überhaupt das Hineinspielen und Eindringen zu erschweren. Richtig gute Mannschaften erwarten mit zwei, manchmal sogar drei Spielern den Gegner eben dort und machen den Raum eng, damit das Kombinieren nicht so einfach gelingen kann.
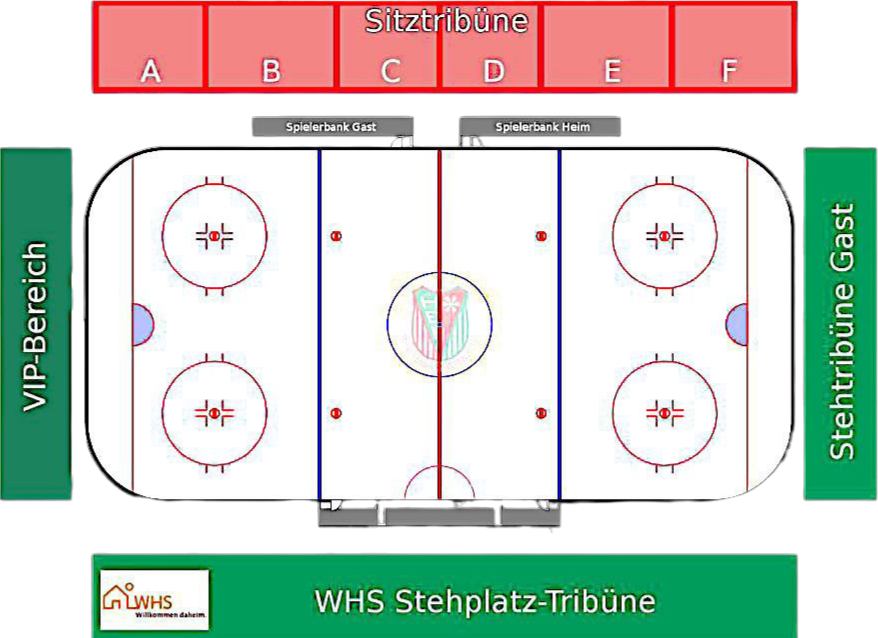
Eishockeyspiel im Verteidigungsdrittel
Wie sich ein Eishockeyspiel gestaltet, hängt natürlich vor allem von den handelnden Personen ab. Es kann zum Beispiel eine gute Idee sein, mit einem Stürmer die Verteidiger zu bedrängen. Machen diese einen Fehler, hat man freie Bahn zum Tor und kann ein leicht erreichtes Erfolgserlebnis einfahren. Meist agieren die beiden Verteidiger in der Verteidigungszone, in dem sie den Puck öfter quer spielen, um die Lücke zu den Angreifern zu finden. Sind sie unsicher, kann ein Angreifer das spüren und hilft dabei, einen Fehler zu machen, indem er Druck aufbaut - allerdings gibt es dann mehr Platz in der Offensive, weil nur vier Gegner Abwehrarbeit leisten.
Die Verteidigung selbst kennt nur das Motto "alles aus dem Weg räumen". Freundlichkeiten werden nicht ausgetauscht - der gegnerische Angreifer wird mittels Check am Schuss gehindert und noch besser ist es, den Puck zu erobern, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen. Dabei wird kompromisslos, aber sportlich fair agiert. Andernfalls handelt man sich eine Strafe ein und schwächt seine eigene Mannschaft.
Verteidigungsdrittel auf dem Eishockeyspielfeld
Die Verteidigungszone vor dem eigenen Tor
Die blauen Linien unterteilen das Spielfeld im Eishockeysport in Drittel. Drittel gibt es auch bei der Spielzeit, bei der Eisfläche haben die Dritte unterschiedliche Funktionen. Dass das eigene Tor umschließende Drittel ist das Verteidigungsdrittel oder auch die Verteidigungszone, denn hier gilt es, einen Treffer des Gegners zu vermeiden.
Angriffsdrittel am Spielfeld des Eishockey
Der offensive Bereich am Eis
Ziel im Eishockeysport ist ebenso wie in vielen anderen Mannschaftssportarten das Schießen von Tore, wobei man möglichst mehr schießen sollte, als der Gegner einem selbst einnetzt. Im Eishockey teilt sich die Spielfläche durch die blauen Linien in Drittel und das Drittel, in dem aus Sicht einer Mannschaft das Tor des Gegners steht, wird Angriffsdrittel genannt.
was ist das Angriffsdrittel im Eishockey?
Das Angriffsdrittel ist jene finale Fläche aus Sicht der Mannschaft, wo sich das gegnerische Tor befindet. In dieses Drittel muss man eindringen, um zum Torerfolg kommen zu können, wobei ab der blauen Linie Gefahr für den gegnerischen Torhüter besteht, weil man mit einem Weitschuss von der blauen Linie bereits Tore erzielen kann und darf. Gerade in Power-Play-Situationen versuchen Verteidiger von dieser Distanz aus oft zum Torerfolg zu kommen.
Davon abgesehen wird mit schnellen Kombinationen versucht, die Mitspieler in das Angriffsdrittel zu bringen, um die Abwehr zu überraschen und ein Tor erzielen zu können. Der Gegner weiß das sehr wohl und versucht durch defensive oder offensive Abwehr das Eindringen bzw. den Torschuss zu vermeiden. Offensiv bedeutet dabei, dass schon an der blauen Linie der Angriff abgefangen werden soll, damit man erst gar nicht ins Drittel gelangen kann, defensiv ist der Kampf Mann gegen Mann um den Puck bzw. auch um Kombinationen zu unterbinden.
Das Angriffsdrittel bietet natürlich verschiedenste Spielvarianten an. Auch der Angriff, der hinter dem Tor an der Bande seinen Ausgang nimmt, ist eine Variante, weil man sich hinter dem Torhüter befindet und ihn vielleicht sogar überraschen kann. Wesentlich ist, dass man sich einig ist und gut kombinieren kann. Dann ist es auch bei einer starken Abwehr möglich, zum Torerfolg zu kommen, wobei der schnelle Gegenangriff aus dem eigenen Drittel heraus immer noch die effektivste Variante ist, da die gegnerische Abwehr nicht in fixer Position ist und aus der Bewegung heraus überrascht werden kann.
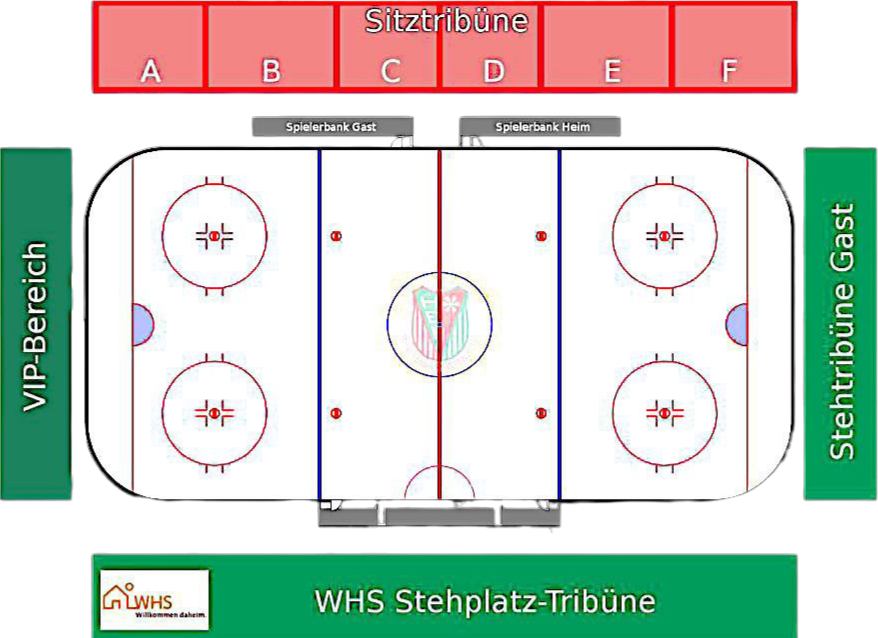
Verändertes Angriffsdrittel
Das Eishockey ist zwar eine Mannschaftssportart und eigentlich auch eine Weltsportart, die es schon lange gibt, aber dennoch gibt es Veränderungen. Das betrifft nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die grundsätzlichen Regeln wie jene der Spielfläche. Eine Entwicklung in diesem Sinne ist mit der Drittelaufteilung entstanden. Drittel ist deshalb als Name richtig, weil die Spielfläche in drei gleich große Teile untergliedert wurde. Aber die Regelungen veränderten diese Aufteilung insofern, als die Mittelzone oder neutrale Zone begrenzt wurde und damit werden Verteidigungsdrittel sowie Angriffsdrittel größer, womit mehr Platz für den Angriff herrscht und die ganze Taktik neu definiert werden muss.
So angenehm dies für die Angreifer ist, so schwierig ist dies für die Verteidiger, aber die Veränderungen haben keine wesentlichen Änderungen gebracht - die starken Nationen sind weiterhin die stärkeren und auch die Menge an Toren hat sich kaum verändert. Es gibt vielleicht mehr offensive Spielaktionen und das Spiel wurde dadurch noch attraktiver.
Neutrale Zone
Neutrale Zone am Eishockeyspielfeld
Platz für den Angriffsaufbau
Mit den beiden blauen Linien wird das Spielfeld im Eishockey in Drittel unterteilt und das mittlere Drittel wird als neutrale Zone bezeichnet. Das liegt daran, dass hier weder das Tor der einen noch der anderen Mannschaft zu finden ist und damit ist die unmittelbare Gefahr nicht gegeben.
Welche Funktion hat die Neutrale Zone im Eishockey?
Die neutrale Zone so bezeichnet, weil hier keine wirkliche Definition für die Spielsituation zutrifft. Man greift nicht wirklich an und verteidigt auch nicht und es besteht keine unmittelbare Gefahr für das eigene Tor, aber das stimmt natürlich auch nur bedingt. Denn wenn man hier den Puck durch einen Fehler und/oder Pech verliert, kann die gegnerische Mannschaft sehr schnell in den Angriff umschalten und den Mitspieler in die Angriffszone bringen. Da man selbst gerade einen Angriff aufbauen wollte, sind die eigenen Mitspieler aufgerückt und die Verteidigung nicht in Bestbesetzung und optimaler Position vorhanden. Ein Konter kann entstehen, der gefährlich ist.
Daher ist die Spieltaktik gerade in der neutralen Zone wesentlich. Rückt man gut auf, kann man schöne Angriffszüge spielen, gleichzeitig entblößt man seine eigene Abwehr. Steht man zu weit hinten, hat man eine sichere Abwehrlinie, aber nach vorne geht nicht viel und ein, zwei Mitspieler stehen der gesamten gegnerischen Mannschaft gegenüber.
In der neutralen Zone befindet sich auch der Anspielkreis, der genutzt wird, um ein Spiel zu beginnen, sei es bei Drittelbeginn oder sei es zur Wiederaufnahme des Spieles nach einem erzielten Tor. Dabei wird mittels Bully zwischen jeweils einem Spieler pro Mannschaft ausgekämpft, welche Mannschaft in den Puckbesitz kommt, um einen Spielzug zu beginnen.
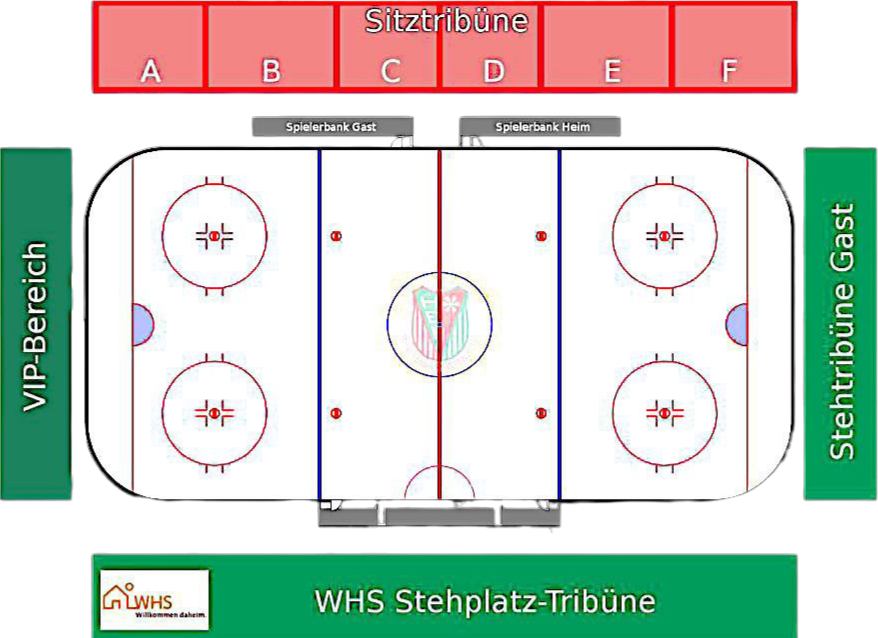
Neutrale Zone im modernen Eishockey
Das Eishockey ist zwar eine Mannschaftssportart und eigentlich auch eine Weltsportart, die es schon lange gibt, aber dennoch gibt es Veränderungen. Das betrifft nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die grundsätzlichen Regeln wie jene der Spielfläche. Eine Entwicklung in diesem Sinne ist mit der Drittelaufteilung entstanden. Drittel ist deshalb als Name richtig, weil die Spielfläche in drei gleich große Teile untergliedert wurde. Aber die Regelungen veränderten diese Aufteilung insofern, als die Mittelzone oder neutrale Zone begrenzt wurde und damit werden Verteidigungsdrittel sowie Angriffsdrittel größer, womit mehr Platz für den Angriff herrscht und die ganze Taktik neu definiert werden muss.
So angenehm dies für die Angreifer ist, so schwierig ist dies für die Verteidiger, aber die Veränderungen haben keine wesentlichen Änderungen gebracht - die starken Nationen sind weiterhin die stärkeren und auch die Menge an Toren hat sich kaum verändert. Es gibt vielleicht mehr offensive Spielaktionen und das Spiel wurde dadurch noch attraktiver.
Tor, Torraum & Torlinie
Eishockeytor und seine Dimensionen
Das Ziel des Eishockeyspiels
Auf den ersten Blick erscheint das Tor im Eishockeysport als sehr klein und der massiv ausgepolsterter Torhüter ist riesengroß davor. Doch wenn man bedenkt, dass der Puck klein ist und mit großer Geschwindigkeit auf das Tor geschossen wird, relativiert sich diese Ansicht wieder. Bei einem Tor, wie man es im Fußball verwendet, würde jedes Spiel 60:60 enden, da die Torleute keine Chance auf eine erfolgreiche Verteidigung hätten.
Wie groß ist das Eishockeytor?
Das Tor im Eishockey ist 1,83 Meter breit und 1,22 Meter hoch. Es ist in der Eisfläche meist mit biegsamen Kunststoffstiften fixiert, sodass das Tor an seinem Platz bleibt, aber dennoch nachgeben kann, wenn Spieler dagegen prallen. Das reduziert die Verletzungsgefahr, bedeutet aber auch den Abbruch der Spielaktion, sobald das Tor aus seiner Halterung herausgelöst wurde. Und das kann im Spiel recht bald passieren, wenn die Spieler im Zweikampf aufeinanderprallen und das Tor mitreißen.
Dass das Tor aus seiner Verankerung gerissen werden kann, ist enorm wichtig. Würde das Tor nicht nachgeben, dann könnten sich die Spieler sehr schwer verletzen, da sie mit großer Wucht und Geschwindigkeit herangeflogen kommen, speziell bei einem schnell vorgetragenen Angriff, bei dem man mit voller Geschwindigkeit zum Tor eilt - Verteidiger wie Stürmer.
Was aber nicht passieren darf, ist das absichtliche Herauslösen des Tores aus der Verankerung - etwa, um eine gefährliche Aktion zu unterbinden. Solche Aktionen können auch zu einer Strafe führen.
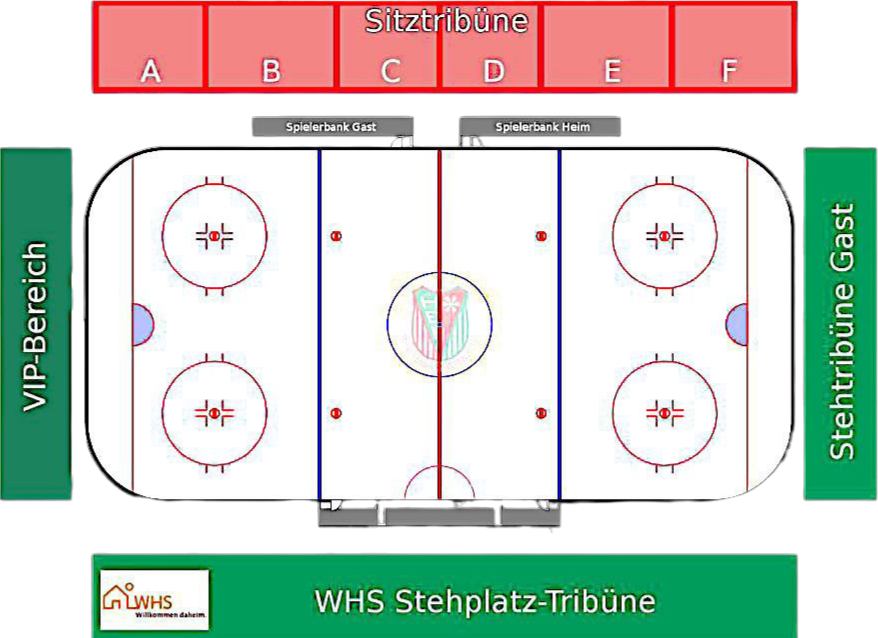
Standort der Tore
Im Eishockeysport stehen die Tore nicht auf einer Linie mit dem Abschluss des Spielfeldes zu beiden Seiten, weil das auch technisch durch die Bande gar nicht ginge. Stattdessen sind sie in das Spielfeld eingerückt und befinden sich an der roten Torlinie. Damit wird es möglich, hinter dem Tor eine Aktion einzuleiten oder auch eine Abwarteposition einzunehmen.
Typisch für das Eishockeyspiel ist zum Beispiel ein Verteidiger, der mit dem Puck hinter das eigene Tor fährt und dort verharrt, bis der Spielerwechsel im Team erfolgt ist. Erst danach spielt er den Puck nach vorne, um eine Angriffsaktion zu beginnen. Gegenteilig ist der Versuch, einen Mitspieler hinter dem gegnerischen Tor anzuspielen, da dieser im Rücken des Torhüters einen Angriff versuchen kann. Dadurch kommt es zu überraschenden Momenten und die Verteidiger müssen diese unterbinden, weil der Torhüter kann sich nicht nach hinten und vorne zugleich orientieren.
Das Tor ist zwar sehr klein, aber es ist dennoch ein beliebter Ort für den Puck, den man dort unterbringen möchte. Die Gummischeibe wird mit bis zu 100 km/h Geschwindigkeit - manchmal sogar schneller - auf das Tor geschossen und nur mit guter Reaktionsfähigkeit kann man einen Treffer vermeiden. Es gibt zwar nicht so viele Tore wie im Handball, aber weit mehr als im Fußball und Ergebnisse von 5:3 oder 6:3 sind gar nicht so selten anzutreffen, was aber auch von der Spielanlage der Mannschaften abhängt.
Je offensiver sie agieren, desto eher kann durch einen Konter oder durch eigene Angriffe ein Tor gelingen. Bei sehr vorsichtiger Spielweise sind die Torquoten weit geringer, zum Beispiel auch in den entscheidenden Play-Off Spielen.
Penaltyschiessen ist kein Elferschiessen
Der große Unterschied etwa zum Fußballspiel ist dann gegeben, wenn es zum Elfmeter im Fußball kommt. Der Schütze hat in etwa die gleiche Chance wie der Torhüter, manche meinen den Schützen im Vorteil zu sehen. Engländer mögen das Elfmeterschießen weniger, da verlieren sie meist. Aber das Tor ist groß, der Ball aber auch.
Im Eishockeyspiel hat der Torhüter mit seinen Reflexen gute Möglichkeiten für die Abwehr, aber er bekommt trotzdem einige Tore geschossen. Im Penaltyschießen hat er hingegen eine größere Chance als der Schütze, denn er muss sich "nur" auf den heranstürmenden Spieler konzentrieren. Es gibt keine Nebengeräusche und er kann sich lange hinlegen und so den Puck blockieren. Nicht selten gelingt nur ein Treffer bei sechs Versuchen, weil der Torhüter dann dank des kleineren Tores die stärkere Position innehat.
Torraum vor dem Tor im Eishockey
Schutzzone für den Torhüter
Wie bei vielen Sportarten gibt es auch beim Eishockey einen Torraum, also einen Raum, bei dem der Torhüter besonders geschützt wird. Er hat zwar ohnehin eine sehr massive Schutzkleidung, dennoch ist er ein sensibler Teil der Mannschaft und bei den intensiven Zweikämpfen und dem schnellen Spiel braucht es zusätzliche Spielregeln.
Bedeutung des Torraums im Eishockeyspiel
Eine Vorkehrung für den Schutz des Torhüters ist der Torraum, der sich unmittelbar vor dem Tor befindet und einen Halbkreis von einer Stange zur anderen bildet. Dieser Torraum ist bei der Entscheidung, ob ein Tor geschossen wurde oder nicht, von großer Bedeutung. Wenn ein Angreifer diesen Raum betritt und im Zuge des Torschusses den Torhüter behindert, wird das Tor nicht gegeben.
Damit hat der Torraum zwei Funktionen: einerseits wird ein Angriff auf den Torhüter in diesem Bereich besonders geahndet, um den Torhüter zu schützen und andererseits darf der Torhüter in seinen Aktionen nicht behindert werden, wobei es von der Situation abhängt, wann das der Fall ist. Der Torraum ist das Kriterium als Ort des Geschehens und dieses ist hinfällig, wenn der Torhüter den Bereich verlässt und aktiv in das Spiel davor oder seitlich vom Torraum eingreift.
Die Regel gilt auch, wenn ein anderer Spieler einen Torschuss anbringt, aber sein Kollege den Torhüter stört, berührt oder gar umreißt. Diese Regel dient dem Schutz des Torhüters, damit er nicht durch die Stöcke der Angreifer verletzt werden kann und um in seinem ohnehin eingeschränkten Bewegungsablauf nicht noch weiter behindert zu werden, was bei den ankommenden scharfen Schüssen ohnehin schon ein Problem ist.
Wobei man sich als Angreifer ohnehin die Wut des Gegners zuzieht, wenn man dem Torhüter zu nahe kommt. Der wird mit Aggressivität geschützt, wenn man es übertreibt, Schlägereien inklusive. Denn wer es wagt, den Torhüter anzugreifen, hat die ganze Mannschaft dieses Spielers am Hals. Das sieht keiner gerne, dass man den eigenen Tormann angreift, das gilt auch, wenn man mit dem Schläger nachhakt, obwohl der Torhüter den Puck längst unter Kontrolle hatte.
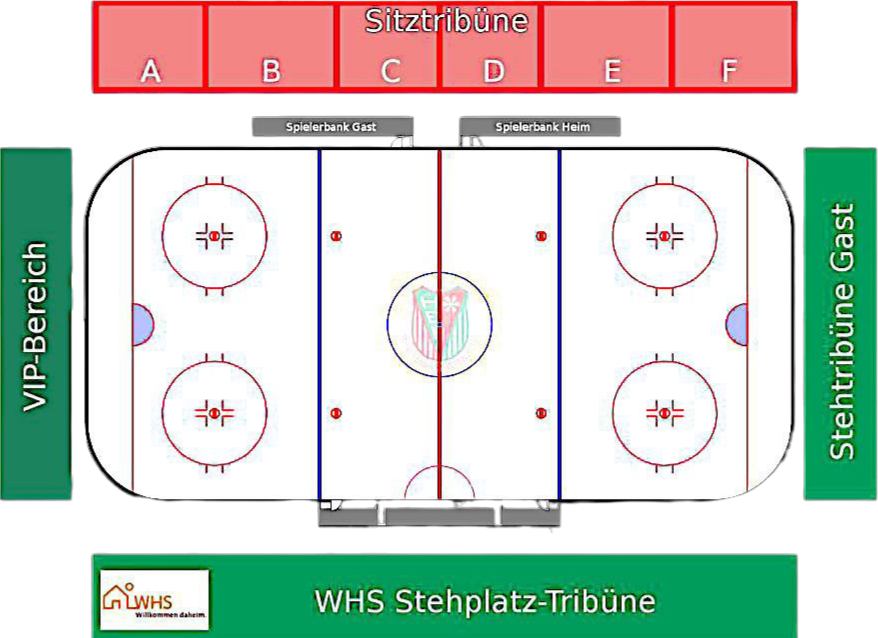
Torlinie im Eishockeyspiel
Linie für die Position des Tores
An beiden Enden der Eisfläche im Eishockey befindet sich jeweils eine Torlinie, bevor das Spielfeld oval abgeschlossen wird. Diese Torlinie ist die Markierung, auf der sich in der Mitte das Tor befindet und spielt für die Entscheidung eine Rolle, ob ein Treffer erzielt wurde oder nicht.
Aufgabe und Bedeutung der Torlinie im Eishockey
Hierbei unterscheidet sich die Torlinie im Eishockeysport deutlich von anderen Torlinien wie zum Beispiel jener im Fußball oder im Handball. Wenn man auf Höhe des Tors beim Fußball den Ball nicht zur Mitte bringen kann, rollt er über die Linie und das Spiel wird unterbrochen. Das ist im Eishockey keineswegs so, weil man hinter dem Tor weiterspielen kann und über die Bande zudem eine gefährliche Aktion einleiten könnte.
Die Torlinie hat aber wie im Fußball eine wesentliche Funktion, nämlich die Feststellung, ob ein Tor gefallen ist oder nicht. Das ist dann entscheidend, wenn der Puck auf das Tor geschossen wird und die Gummischeibe entlang der Linie schlittert. Im Gegensatz zu Fußball & Co. gibt es aber im Eishockey den Fernsehbeweis und das ist auch gut so, denn der Torhüter mit seiner gesamten Ausrüstung verdeckt oft die Sicht auf das Spielgerät. Allerdings ist auch im Fußballsport diese Technik mittlerweile eingesetzt worden, im Eishockey gibt es die Möglichkeit schon lange.
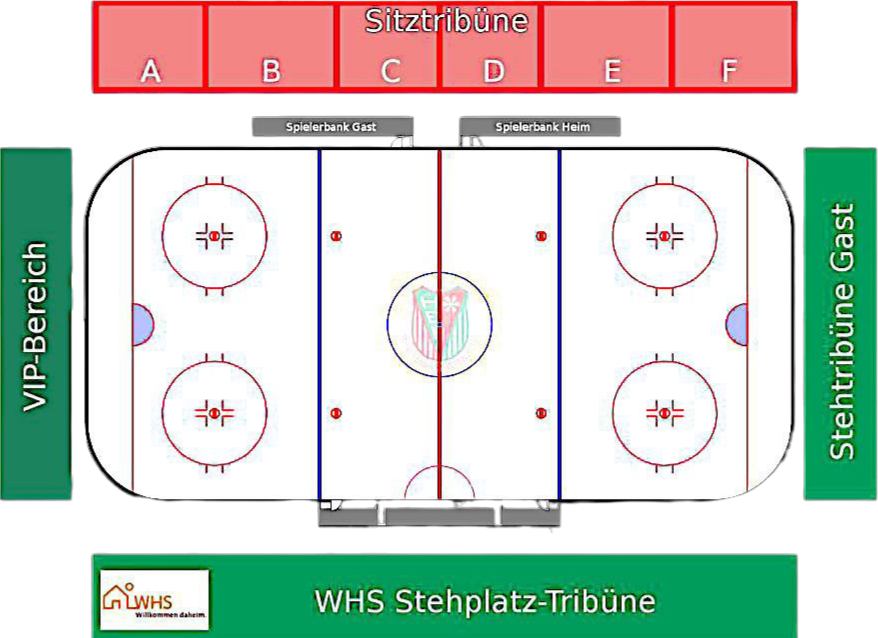
Wann ist ein Tor ein reguläres Tor?
Der Schiedsrichter weiß in den meisten Spielsituationen, ob ein Tor geschossen wurde oder nicht. Hat der Puck die Torlinie vollständig überwunden, dann wurde ein Tor erzielt - wenn der Puck die Linie nicht vollständig überquert hat, ist kein Tor zu geben. Bei strittigen Situationen sieht sich der Schiedsrichter die TV-Bilder an bzw. bekommt Information von einem zusätzlichen Schiedsrichter, der sich die Zeitlupe anschaut und mitteilt, ob es ein Tor war oder nicht. Erst nach dieser Entscheidung geht es mit dem Spiel weiter.
Diese Bilder sind auch bei der Weltmeisterschaft oder großen Ligen für das TV-Publikum sichtbar. Man sieht das Tor von oben und kann daher den Torhüter in Aktion erleben - auch in Zeitlupe - sowie die klar sichtbare Torlinie sowie den Puck mit seiner Bewegung. Mitunter kann man beobachten, dass gar kein Tor gefallen ist, aber der Torhüter selbst nicht mehr weiß, wo sich der Puck befindet und schiebt ihn unwissentlich mit seinen Beinen ins Tor - womit das Tor dann doch zählt.
Das Kriterium bei diesen Entscheidungen ist und bleibt aber die Torlinie und der TV-Beweis ist selbst oft problematisch, wenn zwei oder drei Spieler samt Tormann sich in der Nähe aufhalten und mit ihren Stöcken agieren. Es gibt daher durchaus Situationen, in denen man auch nach dreifacher Betrachtung der Fernsehbilder nicht sicher sagen kann, ob es ein Tor gab oder nicht.
Bande
Bande am Eishockeyspielfeld
Die Abgrenzung der Spielfläche im Eishockey
Beim Handball oder Fußball kann ein Ball über die Seitenlinie rollen und per Einwurf wieder in das Spiel gebracht werden. Im Eishockey ist dies nicht der Fall, denn die Spielfläche wird durch die Bande begrenzt, die man auch braucht, um abbremsen zu können. Und dort trifft man auch immer wieder auf Gegenspieler und tauscht Nettigkeiten aus - oder so ähnlich.
Was ist die Bande im Eishockey?
Als Bande bezeichnet man im Eishockeysport die Abgrenzung der Spielfläche durch eine vollständige Umrahmung, die im unteren Bereich aus Holz oder Kunststoff besteht, auf der eine Plexiglasscheibe angebracht wird. Diese Bande ermöglicht es, dass die Spieler sich dagegen werfen können, um einen Gegner zu behindern, was gemeinhin als Check bezeichnet wird und sie zeigt dem Publikum gefahrlos das Spiel, weil die Plexiglasscheibe Schutz bietet, aber weiterhin den Blick auf das Spiel gewährt.
Action an der Bande im Eishockeyspiel
Natürlich kann der Puck auch schon einmal über diese Scheibe hinwegfliegen, weil ein Schuss abgelenkt worden ist, aber zumeist landet der Puck an der Bande oder trifft das Plexiglas, um in das Spielfeld zurückzufliegen. Die Bande ist damit die Abgrenzung der gesamten Spielfläche und wird nur durch die Eingangstore für die Strafbank sowie für die Spielerbank unterbrochen. Aber auch dort wird die Plexiglas-Schutzscheibe fortgeführt.
An der Bande finden die hitzigsten Duelle um den Besitz des Pucks statt und dort finden auch die meisten Checks statt, weshalb das körperbetonte Spiel hier einen Höhepunkt erlebt. Die Bande kann auch genutzt werden, um die Gegenspieler zu irritieren. So ist es möglich, den Puck in einem bestimmten Winkel zur Bande zu spielen, sodass mit ähnlichem Winkel der Puck auf der anderen Seite weitergereicht wird. Auf diese Weise kann ein Verteidiger ausgespielt werden und der Mitspieler kann einen gefährlichen Angriff wagen.
Obwohl das körperbetonte Spiel an der Bande üblich ist, darf man sich dort aber auch nicht alles erlauben. Gefährliche Attacken werden unterbunden und besonders gefährliche auch mit einer Strafzeit belegt. Attacken wie Cross-Check oder Haken werden ohnehin mit zumindest zwei Minuten Strafzeit belegt.
Bedeutung der Bande
Die Bande macht rein technisch Sinn, weil die Spieler mit hoher Geschwindigkeit agieren und wenn es keine Barriere gäbe, könnten sie nicht abbremsen. Der Puck kann schon längst woanders sein und selbst ist man aber noch in der Vorwärtsbewegung - eigentlich in der falschen Richtung. Damit ist die Bande auch ein Werkzeug, um seine Bewegungen gestalten zu können. Da man weiß, dass man hier abgebremst wird, braucht man vorher nicht großartig abzubremsen.
Der zweite Faktor ist natürlich, dass man dem Gegner ein nettes "Hallo" entgegenbringen kann, in dem man ihn checkt. Das bedeutet, dass man ihn etwa seitlich mit seinem Körper gegen die Bande drückt und versucht, ihn so vom Puck zu trennen. Es gibt auch die erlaubte Möglichkeit, einen Spieler, der gar nicht im Puckbesitz ist, auf diese Art und Weise zu behindern, damit er bei einer Angriffssituation nicht mitwirken kann.
Die Abgrenzung kann auch genutzt werden, um, wie schon ausgeführt, einen Spielzug über die Bande zu wählen, aber das wird selten umgesetzt. Einerseits kann ein Gegner leicht mit dem Schläger den Puck abfangen, da der Schläger die Reichweite deutlich erhöht. Dann ist der Gegner im Puckbesitz und man hat ein Problem. Andererseits hat man selten die Ruhe im Spiel, um genau den Winkel treffen zu können. Es macht viel mehr Sinn, auf der Eisfläche einen Mitspieler mit einem langen Pass einzuschalten.
Anspielkreise
Anspielkreis am Eishockeyspielfeld
Fünf Anspielkreise für das Bully
Ein wesentlicher Spielzug im Eishockeysport ist das Bully, zu Deutsch das Anspiel. Ein Bully wird von jeweils einem Spieler pro Mannschaft durchgeführt, wobei es darum geht, den Puck, die Gummischeibe, die der Linesman - der Schiedsrichter-Assistent - auf das Eis wirft, unter Kontrolle zu bringen. Dabei wird der Puck meist nach hinten zu den Mitspielern gepasst, sodass der Puck in der eigenen Mannschaft ist und ein Angriffsversuch gestartet werden kann.
Fünf Anspielkreise auf der Eisfläche für das Bully
Das Bully kann nicht irgendwo auf dem Eis ausgeführt werden, sondern es findet an fünf vorgesehen Plätzen statt. Man spricht von Anspielkreise bzw. Anspielpunkte, wobei ein zentraler an der roten Linie in der Mitte des Spielfeldes zu finden ist. Hier wird das Bully ausgeführt, wenn ein Drittel beginnt oder wenn ein Tor erzielt worden war und das Spiel auf diese Weise seine Fortsetzung findet. Nach jedem Torerfolg findet man sich also in der Mitte ein, um mit einem Bully das Spiel weiterzuführen.
Vier weitere Anspielkreise gibt es in den Verteidigungszonen der beiden Mannschaften, also zwei in der Verteidigungszone der linken und zwei in der Verteidigungszone der rechten Mannschaft, jeweils links und rechts vom Torhüter aus gesehen. Diese Anspielkreise beinhalten den Punkt, wo der Linesman den Puck aufs Eis wirft und auch die Linien für die Position der beiden Kontrahenten, die das Bully ausführen. Jeweils ein Spieler jeder Mannschaft gibt Zeichen, dass er für das Bully bereit ist und alle anderen Spieler haben sich vom Anspielkreis zu entfernen, was ohnehin nötig ist, um für die weiteren Spielzüge die richtige Position zu haben.
Immer wieder ist zu beobachten, dass ein Linesman einen Spieler vom Bully entfernt, weil sich dieser nicht richtig verhalten hat und dann übernimmt seine Aufgabe ein Kollege aus dessen Mannschaft. Die Linien sind eine wichtige Orientierungshilfe, um sich richtig aufzustellen, damit das Bully ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.
Mit den Anspielkreisen hat man die fix vordefinierte Position auf der Eisfläche und das ist bei jeder Eisfläche, die für ein Eishockeyspiel vorgesehen ist, genauso festgelegt und wesentlich für die ordnungsgemäße Durchführung.
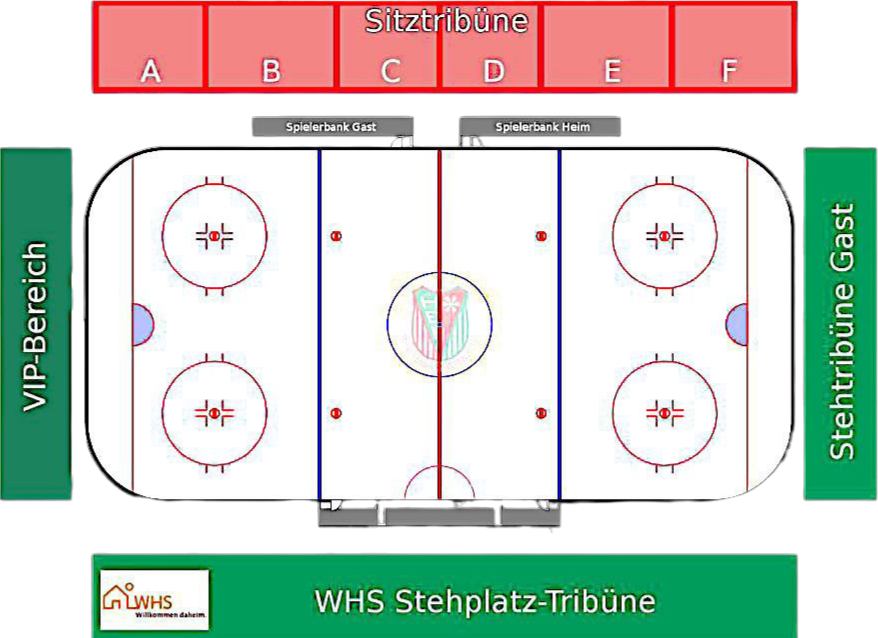
Mannschaft
Eishockeymannschaft und deren Mannschaftsteile
Torwart, Verteidiger und viele Angreifer
Die Mannschaft im Eishockeysport setzt sich auf der Eisfläche aus sechs Spielern zusammen, und zwar dem Torhüter, zwei Verteidigern und drei Angreifern. Insgesamt gibt es natürlich weit mehr als diese 6 Spieler, da man mit Linien spielt. Dabei verändert die Spielsituation die Position und Aufgabe so schnell, dass mit Ausnahme des Torhüters eigentlich alle Spieler alle Aufgaben übernehmen.
Zusammensetzung der Mannschaft im Eishockeyspiel
Denn wenn es ein Power-Play gibt, ist der Verteidiger an der blauen Linie auch gleichzeitig ein sehr torgefährlicher Angreifer, der mit einem Fernschuss ein Tor zu erzielen versucht, in der Defensive ist wiederum der Mittelstürmer wie seine Kollegen an der Seite in die Abwehrarbeit eingebunden, sodass die Trennung, wie man sie vom Fußballsport kennt, nicht erfolgt. Angriff und Verteidigung sind eher mit dem Handballsport zu vergleichen, wo Angreifer genauso verteidigen wie Verteidiger angreifen. Auch Basketball könnte man als Vergleich heranziehen.
Im Eishockey sind aber nicht nur die Aufgaben sehr schnell gewechselt, auch die Positionen durchmischen sich sehr schnell. Der linke Verteidiger ist dann rechts zu finden und der rechte Verteidiger deckt die linke Seite ab, weil im Zusammenhang mit der Abwehrarbeit einfach dieser Tausch notwendig geworden ist. Und dieser ständige Wechsel von Positionen und Aufgaben bringt auch die meiste Gefahr für die taktischen Möglichkeiten.
Denn wenn man nur einen Augenblick unachtsam ist, läuft man sofort in einen Konter, weil man zu weit aufgerückt ist. Das ist im Eishockey mit einem langen Pass aus der Verteidigung schnell erledigt, während der Gegner zu dritt in den Angriff übergegangen sind und seine Abwehrreihe bloßgestellt hat.
Gliederung der Mannschaft
Auf dem Eis sind die besprochenen sechs Spieler, wobei die beiden Verteidiger auch als Verteidigungspaar und die drei Angreifer als Angriffslinie bezeichnet werden. Alle fünf Feldspieler zusammen werden häufig als Block oder auch als Linie bezeichnet. Die Mannschaft setzt nicht nur aus diesen Spielern auseinander, sondern aus 20 Stück, die sich schnell abwechseln. Die 1. Linie umfasst die besten Spieler, die 2. Linie die nächsten guten Leute und in der 3. Linie spielen junge Spieler oder auch weniger erfolgreiche Akteure. Zu Beginn eines Spiels gibt es auch eine 4. Linie, die aber je nach Situation auch wieder aufgelöst wird. Dann teilt der Trainer die Spieler den verschiedenen Linien zu.
Es kann auch sein, dass eine Linie aufgelöst wird und die besten Spieler des Tages zusammengeführt werden, etwa der Mittelstürmer aus der 1. Angriffslinie mit den Flügelstürmern aus der 2. und 3. Linie, um doch noch das Spiel umzudrehen, weil die bisherige Zusammenstellung nicht geklappt hat.
Im Fußballspiel ist die Startaufstellung auch bis zum Schluss gegeben, nur drei Spieler dürfen getauscht werden. Das wäre im Eishockeyspiel undenkbar, weil es viel zu intensiv ist und nach meist einer Minute ein Wechsel erfolgen muss. Daher kann ein Verein oder auch eine Nationalmannschaft nur erfolgreich sein, wenn auch die Spieler der 3. Linie ihre Aufgabe erfüllen.
Begriffe zur Mannschaft
Rund um den Eishockeysport haben sich viele Begriffe herausgebildet, die die Mannschaft betreffen.
Verteidigung
- Torhüter
- Verteidiger
- Verteidigerpaar
Angriff
- Mittelstürmer oder Center
- Flügelstürmer oder Wing
- Angriffslinie
- Extra Attacker: zusätzlicher Angreifer bei Spielende (bei Rückstand)
- Playmaker oder Spielmacher: der kreative Kopf des Angriffs
Allgemein
- Home Team oder Heimmannschaft
- Road Team oder Auswärtsmannschaft
- Feldspieler
- Enforcer oder Goon
- on the fly: Wechsel während laufendem Spiels (auch: fliegender Wechsel)
- Penaltykiller: Spieler (Verteidigung + Angriff) in Unterzahl
- Roster: Kader der ganzen Mannschaft
- Starting Six: die Anfangsformation bei Spielbeginn
Begriffe zur Eishockeymannschaft
Torhüter (stets im Mittelpunkt)
Beschreibung: Torhüter und Ersatztorhüter
Verteidiger (auch Verteidigerpaar)
Beschreibung: Verteidiger und Verteidigerpaar
Mittelstürmer und Flügelstürmer
Beschreibung: Mittelstürmer oder Center und Flügelstürmer oder Wing
Angriffslinie und ihre Bedeutung
Beschreibung: Angriffslinie
Heimmannschaft und Auswärtsteam
Beschreibung: Home Team und Road Team
Feldspieler (wechseln schnell ihre Funktion)
Beschreibung: Feldspieler
Enforcer oder Goon (wird auf gefährlichen Gegner angesetzt)
Beschreibung: Enforcer oder Goon
Tor- und Ersatztorhüter
Torhüter in der Eishockeymannschaft
Gut geschützt und doch aktiv
Im Eishockey ist der Torhüter mit der Aufgabe betraut, die gegnerischen Schüsse zu entschärfen, sodass man keine Tore erhält und siegreich das Eis verlassen kann. Da diese mit dem Puck geschossen werden und mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h herangeflogen kommen, braucht der Torhüter einen besonderen Schutz.
Mission: Tore im Eishockeyspiel verhindern
Eigentlich hat er einen einfachen Job, denn das Tor ist mit 122 cm Höhe viel kleiner als jenes vom Fußballsport und mit 183 cm Breite ist auch dieses Maß überschaubar. Es wird dabei aber vergessen, dass der Puck mit hoher Geschwindigkeit geschossen wird und dass er viel kleiner ist als der Fußball. Damit braucht man noch mehr Reaktionsfähigkeit und natürlich eine entsprechende Polsterung, weil der direkte Treffer ohne Schutzkleidung gefährlich werden würde.
Das Gesicht ist durch eine Maske geschützt, zumindest nennt man den Helm mit dem Schutzgitter so. An den Beinen trägt der Torhüter Torwartschienen, mit denen er den Puck abwehren kann und auch die Hände sind speziell geschützt durch Handschuhe, die nur der Torwart besitzt. Der Blocker ist der Handschuh jener Hand, mit der er seinen Schläger hält und ist viel größer als die Hand selbst. Die freie Hand wird durch den Fanghandschuh ausgerüstet, sowohl als Schutz für die Hand selbst als auch als Möglichkeit, das scharfe Geschoss zu fangen.
Der Torhüter spielt aktiv im Eishockeysport mit, indem er einen Puck nicht nur festhalten kann, sondern bei Bedarf mit dem Schläger zu seinem Verteidiger weiter passt. Ist ein Angreifer in der Nähe, hält er den Puck hingegen fest, um die Situation zu entschärfen. Der Schiedsrichter pfeift daraufhin das Spiel ab und es gibt ein Bully als nächste Spielaktion.
Wichtig ist auch die Position des Torhüters in der Mannschaft, denn er ist jener Spieler, der vom gegnerischen Angreifer nicht attackiert werden darf. Wenn dies passiert, gibt es sofort Mitspieler, die ihn verteidigen und viele Schlägereien im Eishockeysport sind so entstanden. Der Torhüter wird durch den Puck sowieso angegriffen, aber körperlicher Kontakt oder Nachschlagen mit dem Schläger geht gar nicht und wird bestraft. Böse Blicke sind dabei noch die harmlosere Aktion und der Schiedsrichter hat mit seinem Team Mühe, die Streitparteien zu schlichten. Dieses Verteidigungsverhalten gibt es aber bei vielen Sportarten - niemand darf den Torwart angreifen.
Spielaktionen des Torhüters
Dass der Torhüter das Tor hütet, verrät schon sein Name, aber er muss dabei auch darauf achten, wie er dies durchführt. Wenn ein Angreifer auf das Tor schießt, ist es keine ratsame Aktion, wenn der Torhüter den scharfen Schuss nach vorne abprallen lässt. Man spricht dann von einem Rebound und das bedeutet, dass ein weiterer Angreifer (oder auch der gleiche) vor dem Tor eine zweite Chance erhält, ein Tor zu erzielen.
Selbst scharf geschossene Pucks müssen zur Seite abgewehrt werden, damit man diese Möglichkeit nicht erhält. Zwar kann auch dann ein Gegner versuchen, aus spitzem Winkel einzunetzen, aber das ist viel schwieriger und die Verteidiger sind ja auch noch da.
Die zweite wichtige Aktion ist, dass der Torhüter erkennt, was Sache ist. Das bedeutet, dass er das Spiel lesen können muss. Hat er den Puck gefangen und legt ihn sofort auf die Eisfläche, um ihn mit dem Schläger weiterzuspielen, dann ist das nur möglich, wenn seine Verteidiger da sind und die gegnerischen Angreifer nicht. Achtet er darauf nicht, kann ein billiges Tor entstehen. Das Gleiche gilt, wenn der Torhüter hinter das Tor fährt, um den Puck, der von der anderen Spielhälfte herüber geschossen wurde, mit dem Schläger einzusammeln, um ihn einem Mitspieler zuzuspielen. Wenn statt des Mitspielers ein Angreifer den Puck erhält und das Tor ist leer, ist das auch keine gute Idee.
Ersatztorhüter im Eishockey
Weniger Eiszeiten, aber manchmal überraschend am Eis
Eine Eishockeymannschaft umfasst insgesamt drei Torhüter, wie man dies auch beim Fußball vorfindet. Und so wie im Fußballsport oder in anderen Mannschaftssportarten gibt es eine Nummer eins und dieser Spieler ist dann ständig im Einsatz, wenn es darum geht, das Tor zu hüten und gegnerische Treffer zu verhindern. Aber es kann auch durch eine Verletzung schnell dazu kommen, dass einer der Ersatztorhüter zum Einsatz kommt oder es passieren andere unvorhergesehene Aktionen.
Ersatztorhüter im Eishockeyspiel springt ein
Es ist grundsätzlich problematisch, dass man immer fit sein muss und dann doch nur beim Spiel zuschauen kann, während der Kollege als Torhüter gefeiert wird. Aber es braucht nur eine Verletzung auftreten und schon ist man selbst im Tor, obwohl man vorher nur zuschauen konnte und dabei muss man zeigen, was man kann. Ein Aufwärmen ist fast nicht möglich und man legt einen Kaltstart hin, was bei den eingespielten Feldspielern, vor allem natürlich bei den gegnerischen Angreifern zum großen Thema wird. Die wissen natürlich, dass der Torhüter ein paar Schüsse braucht, um auf Touren zu kommen und wollen diese Phase ausnutzen.
Neben der Verletzung des wichtigsten Torhüters gibt es aber auch andere Möglichkeiten, warum die Nummer eins nicht spielt. Eine kann darin bestehen, dass es eben keine fixe Nummer eins gibt und der Trainer die verschiedenen Akteure testen will. Er rotiert die Torhüter und überlegt sich, welchen er zur Nummer eins machen möchte. Das ist nicht unproblematisch, weil die Verteidiger und der Torhüter ein eingespieltes Team sein sollten. Jeder weiß fast blind, wie der andere spielen wird und mit dem Wechsel des Torhüters muss man sich neu einstellen.
Die Nummer Eins hat keine Lust
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, warum der Ersatztorhüter auf einmal in den Mittelpunkt rückt. Das ist nämlich dann der Fall, wenn die Nummer eins verweigert. Wenn eine Mannschaft aussichtslos 0:6 zurückliegt, kommt es schon vor, dass der Torhüter genug hat und das Eis verlässt, sodass einer der beiden Ersatztorhüter dessen Position einnimmt. Gerade dann, wenn man ein knappes Spiel erwartet und plötzlich Tor um Tor kassiert, kann es sein, dass die Nummer eins den Dienst verweigert und nach einem halben Dutzend Tore den Bedarf gedeckt hat.
Wie auch immer - für den Ersatztorhüter ist es die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wenn die Nummer eins nach einigen Treffern aufgibt, wird sie wohl im nächsten Meisterschaftsspiel wieder im Tor stehen, aber bei einer Verletzung ist die Frage, wer statt der Nummer eins die nächsten Spiele bestreiten soll und da ist es wichtig, sich zu zeigen.
Verteidiger & Verteidigerpaar
Verteidiger und ihre Funktion im Eishockeyspiel
Abwehr und Angriff in einer Person
In der Grundaufstellung eines Teams im Eishockey gibt es zwei Verteidiger - den linken und den rechten Verteidiger, die zusammen ein Paar bilden. Aber im Gegensatz zu anderen Mannschaftssportarten lösen sich die Positionen und Aufgaben sehr schnell ab, je nachdem wie der Spielverlauf sich gestaltet und wie die aktuelle Spielsituation zu bewerten ist.
Aufgaben des Verteidigers im Eishockey
Der Verteidiger im Eishockeyspiel ist für die Absicherung des eigenen Tores zuständig, wobei die Stürmer bei einem Gegenangriff mithelfen. Umgekehrt ist der Verteidiger oftmals an der blauen Linie des Angriffsdrittels zu finden und kann per Weitschuss sogar Tore schießen - manche sogar viele Tore im Laufe einer Saison. Somit gibt es Aufgaben in der Defensive und Offensive.
Häufiger Wechsel der Positionen im Spiel
Denn die Wege der gegnerischen Spieler beeinflussen auch das eigene Verhalten und so kann der linke Verteidiger sich sehr schnell auf der rechten Seite wiederfinden, während sein Kollege nach links ausweicht. Häufig arbeiten sie zusammen, wobei die Kollegen aus dem Angriff zurückeilen, um das Loch in der Verteidigung zu stopfen. Genauso schnell kann der Verteidiger aber auch einen Gegenangriff mit einem langen Pass einleiten oder selbst in den Angriff übergehen, wenn die Chance sich bietet.
Das macht die Aufgabe sehr komplex, weil der Eishockeysport auch sehr schnell abgewickelt wird und wenn man sich zu weit nach vorne wagt, kann das böse ins Auge gehen, da die gegnerische Mannschaft eine Lücke in der Abwehr erkennt und einen Konter probiert. Andererseits ist das Zögern bei eigenen Angriffen auch nicht erfolgsfördernd.
Die Hauptaufgabe des Verteidigers ist natürlich die Abwehr der gegnerischen Angriffe. Hier gibt es ein anderes taktisches Konzept, denn an der blauen Linie erwarten die Mitspieler des Angriffes die Gegner und wer dort vorbeikommt, hat die Verteidiger am Hals. Diese versuchen Schussmöglichkeiten zu unterbinden und den Puck zu erobern, um einen Gegenangriff einleiten zu können. Der Verteidiger muss daher sehr die Spielsituation lesen können, um sich richtig zu positionieren. Dafür braucht es Erfahrung und auch ein eingespieltes Team. Wenn man erst nachschauen muss, was der andere Verteidiger so treibt, ist man schon in einer sehr schwachen Position, die die gegnerischen Angreifer ausnutzen können.
Verteidiger wird zum Stürmer
Umgekehrt ist der Verteidiger auch Angreifer, und zwar vor allem dann, wenn es ein Überzahlspiel oder Power-Play gibt. Dann positionieren sich beide Verteidiger an der blauen Linie des Angriffsdrittels, um mögliche Fernschüsse abzugeben. Sie spielen mit den Angreifern zusammen und versuchen den Vorteil der zahlenmäßigen Überlegenheit auszunutzen. Finden sie eine Lücke und bekommen sie den Puck zugespielt, dann wagen sie den Schuss und hoffen, dass der Torwart diesen nicht abwehren kann. Daher sind Verteidiger auch zahlreich in der Torschützenliste zu finden und manche Verteidiger sind sogar ob ihrer scharfen Schüsse gefürchtet.
Aber auch abseits des Überzahlspiels rücken die Verteidiger auf, um auf einen Rückpass zu warten, den sie per Weitschuss von der blauen Linie zu einem Tor ummünzen wollen. Das gelingt nicht immer, aber aus dem Spiel erzielen die Verteidiger sehr häufig Tore, zum Teil auch sehr wichtige.
Die Gefahr ist jedoch die, dass die gegnerische Mannschaft den Puck erhalten könnte und dann einen schnellen Gegenangriff fährt. Dann hat man die Abwehr bloßgestellt und hat ein echtes Problem. Deshalb ist es meist so, dass der offensivere Verteidiger bis in das Angriffsdrittel mitgeht, der defensivere sichert ihn nach hinten ab.
Verteidigerpaar in der Eishockeymannschaft
Zwei Verteidiger als ein Bollwerk
Im Eishockey wird viel über die Linien gesprochen und geschrieben und gemeint sind damit die Blöcke, die abwechselnd eingesetzt werden können. Man kann die Linie als Paket von drei Angreifern und zwei Verteidigern verstehen, aber häufig werden die Angreifer als Angriffslinie und die Verteidiger als Verteidigungspaar verstanden.
Die Angreifer werden dabei auch durchgemischt, was bei heiklen Situationen oder dringend aufholendem Rückstand möglich sein kann, bei den Verteidigern erfolgt das Durchmischen zwar auch, aber man versucht meist, eingespielte Paare zusammen agieren zu lassen. Und so kam auch der Begriff zustande.
Was ist ein Verteidigerpaar in der Eishockeymannschaft
Ein Verteidigerpaar besteht aus den zwei Verteidigern, die zusammen das Eis betreten und die Angriffe der gegnerischen Mannschaft zu unterbinden versuchen. Der wesentliche Faktor ist dabei, dass die beiden Verteidiger aufeinander abgestimmt sind und die Laufwege und die Art des Spiels kennen. Deshalb ist es ein Problem, wenn zwei Spieler in einer spannenden Matchsituation zum ersten Mal zusammen spielen, auch wenn das durchaus möglich ist.
Meistens gibt es so wie bei den Angriffslinien drei oder gar vier verschiedene Verteidigungspaare, die sich gut kennen. Das gilt für die Vereinsebene genauso wie für die Nationalmannschaft. Wenn man sich gut kennt, kann man sich aufeinander verlassen und weiß auch von den Stärken und Schwächen des anderen. Bestimmte Spielsituationen lassen sich so leichter ablesen und man weiß, was man zu tun hat oder was der andere ohnehin erledigen wird. Kennt man diese Eigenheiten nicht, dann entsteht Unsicherheit und diese Unsicherheit ist oft der Grund für Gegentreffer.
Das wissen die Trainer auch nur zu genau und deshalb lassen sie Verteidigungspaare sehr gerne und dauerhaft zusammen agieren. Nur Verletzungen oder ganz spezielle Situationen verändern die Strategie und man kombiniert Spieler auf andere Weise.
Bedeutung der Verteidigerpaare
Warum ist das überhaupt so wichtig? Gerade die Aufgabe der Verteidiger ist für den Erfolg von zentraler Bedeutung, weil man einerseits in den Angriffen mitwirkt und andererseits die letzte Barriere vor dem Torhüter ist, wenn der Gegner angreift. Wenn nun beide Verteidiger zu offensiv agieren, läuft man schnell in einen Konter des Gegners, man verwendet dann auch gerne die Redewendung, dass man ins offene Messer läuft.
Kennen sich die Verteidiger, dann weiß A, dass B gerne nach vorgeht, um mit Weitschüssen Tore zu erzielen und die Angreifer zu unterstützen und sichert nach hinten ab. B kann sich darauf verlassen und so funktioniert das Spiel gut. Wenn beide hinten bleiben, hängen die Stürmer in der Luft, weil sie nicht zur blauen Linie passen können, wenn beide nach vorne gehen, kann mit einem langen Pass der Gegner leicht einen Konterangriff durchführen.
Auch beim Spielaufbau muss man wissen, wie der Partner sich verhält, welche Laufwege er hat. Weiß man das, dann kann man viel sicherer agieren. Natürlich ist jedes Spiel irgendwie im Verlauf anders, aber man erkennt an Kleinigkeiten sofort, was der andere sich überlegt hat. Bei einem wenig bekannten Spieler ist das nicht so einfach. Deshalb sind die Verteidigerpaare oft zusammen agierende Spieler.
Mittel- und Flügelstürmer
Mittelstürmer oder Center im Eishockeyteam
Größte Gefahr vor dem Tor
Die Flügelstürmer agieren im Eishockeyspiel von den Seiten aus, in der Mitte vor dem gegnerischen Tor steht der Mittelstürmer (englisch Center) und wartet auf seine Chance. Es ist dies ein Spieler, der sehr massiv gebaut sein sollte, denn vor dem Tor ist es eng. Die Verteidiger laden den Mittelstürmer nicht zu einer Party ein, sie wollen ihn hier loswerden, damit er erst gar nicht auf die Idee kommen kann, zum Torschuss auszuholen.
Mittelstürmer oder Center: Zentraler Angriffsspieler
Und daher darf man nicht sensibel sein, wenn man im Eishockey als Mittelstürmer spielen möchte. Platz hat man keinen und Zeit, um sich den Puck für den Schuss herzurichten, auch nicht. Außerdem muss man das Spiel gut lesen können und auch Überraschungen bereithalten. Wenn die Flügelstürmer auf der Seite wirbeln, muss man erahnen können, wohin sie den Puck spielen, wenn sie dazu die Gelegenheit bekommen und sich entsprechend in diese Richtung bewegen.
Dabei muss man sich als Mittelstürmer aber von seinen Verteidigern lösen, die genau das vermeiden wollen und auch eine Idee haben, was jetzt für ein Spielzug an der Reihe sein könnte. Daher versucht der Mittelstürmer manchmal eine ganz andere Strategie und weicht vom Torbereich auf die Seite aus, um Löcher zu schaffen, durch die die Flügelstürmer oder manchmal auch vorgerückte Verteidiger zum Torschuss ausholen können. Mit einem Doppelpass kann dies besonders überraschend gelingen.
Offensives Spiel hinter dem Tor
Sehr stark sind die Mittelstürmer auch hinter dem Tor an der Bande, wo sie um den Puck kämpfen und ihre Spieler einsetzen, die vor dem Tor lauern. Diese Situation dreht sich auch oftmals, indem die Flügelstürmer den überraschenden Pass spielen und der Mittelstürmer zentral vor dem Tor auf seine Chance wartet. Für den Torwart sind das sehr unangenehme Situationen, weil sich der Spielaufbau hinter seinem Rücken abspielt und er sich aber selten die Zeit nehmen kann, um zu beobachten, was dort abläuft.
Der Mittelstürmer wird immer gut bewacht, doch der Puck wird sehr schnell gespielt und so gibt es stets Möglichkeiten für den Torerfolg, vor allem bei abprallende Pucks, die an die Stange geschossen wurden oder vom Torwart nur weggeschlagen werden konnten. Dabei spricht man vom Rebound und somit der zweiten Chance, ein Tor zu erzielen. Der Torhüter sollte den Puck zur Seite wegschlagen, aber das gelingt nicht immer.
Gut bewachter Serientäter
Der Mittelstürmer ist auch im Fußball jener Kollege, auf den man besonders gut aufpasst und das ist im Eishockeyspiel nicht anders. Aber das Eishockeyspiel ist sehr dynamisch, sehr schnell und rasch ändern sich die Situationen. Wenn ein Flügelstürmer mit hoher Geschwindigkeit Richtung Tor läuft, kann der Verteidiger nicht einfach zuschauen. Entweder geht er entgegen und verlässt damit den Mittelstürmer oder er passt auf den Mittelstürmer auf. Der Mittelstürmer wird ihm aber nicht den Gefallen machen und die Situation selbst auflösen, er wird die Verteidiger viel lieber in noch größere Probleme bringen.
Und daher kann es gut sein, dass er bestens bewacht wird, aber für einen Augenblick hat er Freiraum und mehr braucht er gar nicht, um zuschlagen zu können.
Flügelstürmer oder Wing im Eishockeyteam
Gefahr von der Seite für den gegnerischen Torwart
Im Eishockeysport gibt es fünf Feldspieler, die sich in zwei Verteidiger und drei Stürmer aufteilen. Durch das schnelle Spiel sind Verteidiger rasch auch Stürmer und umgekehrt Stürmer auch in der Abwehr eingesetzt, aber prinzipiell unterscheidet man bei den Stürmern den Mittelstürmer (Center) von den Flügelstürmern (Wings).
Welche Aufgaben hat der Flügelstürmer im Eishockey?
So wie es bei den Verteidigern einen linken und einen rechten Verteidiger gibt, gibt es diese Aufteilung auch bei den Flügelstürmern, die nicht nur dafür verantwortlich sind, den Mittelstürmer von der Seite aus gut einzusetzen und ihm den Puck zuzuspielen, sondern die selbst sehr große Torgefahr auslösen können. Sie haben durch das kleine Spielgerät mehr Möglichkeiten, den Puck im engen Winkel Richtung Tor zu bringen als beispielsweise ein Fußballer, bei dem der Torhüter das Tor leichter abdecken kann.So wie es bei den Verteidigern einen linken und einen rechten Verteidiger gibt, gibt es diese Aufteilung auch bei den Flügelstürmern, die nicht nur dafür verantwortlich sind, den Mittelstürmer von der Seite aus gut einzusetzen und ihm den Puck zuzuspielen, sondern die selbst sehr große Torgefahr auslösen können. Sie haben durch das kleine Spielgerät mehr Möglichkeiten, den Puck im engen Winkel Richtung Tor zu bringen als beispielsweise ein Fußballer, bei dem der Torhüter das Tor leichter abdecken kann.
Zwar hat der Torhüter natürlich diese Möglichkeit im Eishockey auch, aber durch den kleinen Puck und seine viel höhere Geschwindigkeit gelingen Tore von einer Außenposition öfter. Hier wirkt dann der Center zusätzlich, denn wenn der Torhüter abwehrt, prallt der Puck oft zurück und der Mittelstürmer kann den Puck leichter einnetzen.
Flügelstürmer helfen in der Abwehr mit und sind dafür verantwortlich, die Flügelstürmer der gegnerischen Mannschaft abzubremsen, zu decken und am Spielzug zu hindern. Gleichzeitig sind Flügelstürmer meist jene Spieler, die schnelle Konter ausführen und den Puck rasch in das Angriffsdrittel bringen, um für Torgefahr zu sorgen.
Flügelstürmer im Eishockeyspiel
Die Positionen ändern sich sehr rasch und es kann in einem Konter auch vorkommen, dass ein Verteidiger den Mittelstürmer spielt, aber üblicherweise agieren die Flügelstürmer auf der Seite und versuchen in der Mitte den Mittelstürmer einzusetzen. Um die Verteidigung aber zu irritieren, spielen diese auch gerne umgekehrt, sodass der Mittelstürmer plötzlich auf der Seite agiert und der Flügelstürmer nervt in der Mitte die Abwehr.
Im Power-Play wechseln sich die Positionen nochmals schneller und dann kann der Mittelstürmer auch hinter dem Tor agieren, um seine Mitspieler einzusetzen, aber genauso vorne stehen. Die Flügelstürmer passen sich an. Typisch für den Flügelstürmer ist ein sehr schnelles Eislaufen und deshalb auch schnelle Gegenstöße aus der eigenen Abwehr heraus. Der Flügelstürmer muss immer in Bewegung sein und er muss das Spiel gut lesen können, um rechtzeitig zu starten und für einen Konterangriff bereit zu sein.
Daher ist der Flügelstürmer nicht ganz so ein massiver Kollege wie der Mittelstürmer, aber er muss sich natürlich gegen die Verteidiger auch durchsetzen können, weil willkommen ist man auch auf der Seitenposition nicht.
Angriffslinie
Angriffslinien in der Eishockeymannschaft
Drei Stürmer, die sich gut kennen
Die Funktionen von Flügelstürmer und Mittelstürmer (englisch Wings und Center) sind bestens bekannt, aber wirklich effizient werden diese Angreifer für das eigene Team erst, wenn sie sich gut kennen. Denn dann kennen sie die Laufwege der anderen, ihre Stärken und Schwächen und können sich besser gegenseitig unterstützen, weshalb die Bildung einer Angriffslinie Sinn macht.
Was ist die Angriffslinie im Eishockey?
Die Angriffslinie besteht im Eishockey aus drei Stürmern - zwei Flügelstürmer und ein Mittelstürmer, die üblicherweise immer zusammenspielen und so effektiver sind. Daher werden nicht irgendwelche drei Stürmer aufs Eis geschickt, um für die Tore zu sorgen und auch nicht die besten drei Stürmer, die das Team gerade zur Verfügung hat, sondern drei Stürmer, die sich sehr gut kennen und eingespielt sind. Das ist auf Vereinsebene recht einfach herzustellen, da man ja jede Wochen zwei oder gar drei Spiele gemeinsam absolviert, beim Nationalteam ist das schon schwieriger.
Der Hintergrund ist natürlich, dass die beiden Flügelstürmer wissen, wie sie am besten den Mittelstürmer einsetzen können und dieser kennt wiederum die beliebtesten Tricks der Flügelstürmer und kann schnell erkennen, was sie mit dem Puck vorhaben. Kennt man die Eigenheiten nicht so gut, dann gibt es Abstimmungsprobleme und die Verteidigung kann sich leichter befreien und durchsetzen. Daher ist das eingespielte Team von drei Stürmern sehr wichtig.
Der Trainer setzt meist auf die gleichen drei Leute für eine bestimmte Linie, aber es kann sich ein Spieler verletzt haben oder ein Spieler ist so ganz und gar nicht in Form - dann muss man umstellen. Es kann aber auch passieren, dass im Spiel nichts klappen will und man versucht es mit einer anderen Zusammensetzung.Der Hintergrund ist natürlich, dass die beiden Flügelstürmer wissen, wie sie am besten den Mittelstürmer einsetzen können und dieser kennt wiederum die beliebtesten Tricks der Flügelstürmer und kann schnell erkennen, was sie mit dem Puck vorhaben. Kennt man die Eigenheiten nicht so gut, dann gibt es Abstimmungsprobleme und die Verteidigung kann sich leichter befreien und durchsetzen. Daher ist das eingespielte Team von drei Stürmern sehr wichtig.
Der Trainer setzt meist auf die gleichen drei Leute für eine bestimmte Linie, aber es kann sich ein Spieler verletzt haben oder ein Spieler ist so ganz und gar nicht in Form - dann muss man umstellen. Es kann aber auch passieren, dass im Spiel nichts klappen will und man versucht es mit einer anderen Zusammensetzung.
Veränderungen innerhalb des Spiels
So wie es das Verteidigungspaar in der Abwehr gibt, gibt es daher auch die Angriffslinien im Angriff. Sie setzen sich aus den beiden Flügelstürmern und dem Mittelstürmer zusammen und diese Angriffslinien werden weit öfter eingesetzt als die Linien generell. Der Unterschied ist, dass eine Linie alle fünf Feldspieler einbezieht, sodass drei Stürmer und zwei Verteidiger zusammen agieren. Das kommt vor, am Beginn eines Spieles sogar häufiger, aber je länger das Spiel dauert, desto eher wird man eine Angriffslinie austauschen oder ein Verteidigungspaar. Und es hängt auch von den Spielsituationen ab.
Denn bei einem Power-Play mit zahlenmäßiger Überlegenheit wird man vielleicht die torgefährlichsten Stürmer und schussstärksten Verteidiger aufbieten, bei einem Power-Play, bei dem man selbst einen Mann weniger auf dem Eis hat, wird man die Leute einsetzen, die beim Verteidigen ihre absoluten Vorzüge aufweisen können. Und daher können Angriffslinien mit anderen Verteidigungspaaren durchaus mehr Sinn machen als Linien mit fünf Spielern. Man hat so auch mehr Kombinationsmöglichkeiten.
Die Angriffslinien sind meist auf vier Teams aufgeteilt, also auf vier Linien zu drei Stürmer, wobei am Ende des Spieles bei knappem Spielstand nur noch die besten drei Linien aufgeboten werden. Die erste Angriffslinie ist dabei jene mit den stärksten Stürmern, die dritte und vierte Linie jene mit den jüngeren und noch nicht so erfahrenen Spielern.
Home & Road Team
Home Team oder Heimmannnschaft im Eishockey
Heimvorteil im Match
In so ziemlich jeder Mannschaftssportart ist der Heimvorteil ein wesentliches Kriterium, sei es im Handball, im Fußball oder eben auch im Eishockeysport. Es gibt die verschiedensten Ausdrücke für die Heimmannschaft und da das Eishockey vor allem in Nordamerika eine große Heimat hat, hat sich der Ausdruck Home Team auch abseits von Nordamerika etabliert.
Home Team oder Heimmannschaft
Das Home Team oder auch in der deutschen Übersetzung die Heimmannschaft kann im eigenen Stadion das Spiel austragen, meist ein Meisterschaftsspiel und hat das eigene Publikum im Rücken. Diese Unterstützung ist wesentlich für das Selbstvertrauen und man kennt das Stadion mit den Lichtverhältnissen und allen anderen Details besser als jedes andere, auch wenn die Eisfläche immer die gleiche ist. Die Stimmung ist großartig und man wird für jede gelungene Aktion bejubelt, was natürlich psychologisch sehr wichtig sein kann - speziell dann, wenn es ein sehr wichtiges Spiel ist oder wenn das Spiel gerade in die entscheidende Phase geht.
Man spricht im Eishockeysport auch oft vom eigenen Eis und damit meint man in Wirklichkeit das Heimstadion mit seinen Fans, wobei es keine Garantie gibt, dass man auch wirklich erfolgreich sein wird. Tatsächlich gibt es Mannschaften, die auswärts mitunter stärker agieren als daheim, weil sie in der Defensive gut stehen und über den Konter erfolgreich sind, aber nicht das Spielermaterial haben, um ein Spiel gestalten zu können.
Daheim erwartet man vom Home Team, dass Druck auf den Gegner ausgeübt wird, auswärts ist diese Erwartung nicht gegeben und so kann man sein defensives Konzept leichter umsetzen. Generell ist aber die Erwartung die, dass ein Verein daheim deutlich öfter gewinnt als auswärts und damit die Basis für eine gute Saison aufbaut. Wenn man daheim die Spiele nicht gewinnen kann, wird es auswärts als Road Team noch schwieriger, erfolgreich zu sein und die Gefahr, in eine Niederlagenserie zu rutschen ist durchaus gegeben.
Heimvorteil oder doch nicht?
Der Vorteil eines Home Teams ist auch von der Situation abhängig. Denn wenn es zum Beispiel zu den Play-Off Spielen kommt, dann gibt es ganz enge Partien und nur selten klare Siege. Einzelne Aktionen entscheiden die Spiele und nicht immer ist die Heimmannschaft dabei die glücklichere.
Eine Besonderheit ist das Home Team im Zusammenhang mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Gerade in der höchsten Klasse, der Division I, mit den Starmannschaften von Kanada über Russland bis Schweden ist die Austragung der WM im eigenen Land kein Garant für den Gewinn des Titels. Oft ist es sogar gegenteilig, weil der Erwartungsdruck so groß ist, dass man diesem kaum entsprechen kann.
Road Team oder Gastmannschaft im Eishockey
So wie es das Verteidigungspaar in der Abwehr gibt, gibt es daher auch die Angriffslinien im Angriff. Sie setzen sich aus den beiden Flügelstürmern und dem Mittelstürmer zusammen und diese Angriffslinien werden weit öfter eingesetzt als die Linien generell. Der Unterschied ist, dass eine Linie alle fünf Feldspieler einbezieht, sodass drei Stürmer und zwei Verteidiger zusammen agieren. Das kommt vor, am Beginn eines Spieles sogar häufiger, aber je länger das Spiel dauert, desto eher wird man eine Angriffslinie austauschen oder ein Verteidigungspaar. Und es hängt auch von den Spielsituationen ab.
Denn bei einem Power-Play mit zahlenmäßiger Überlegenheit wird man vielleicht die torgefährlichsten Stürmer und schussstärksten Verteidiger aufbieten, bei einem Power-Play, bei dem man selbst einen Mann weniger auf dem Eis hat, wird man die Leute einsetzen, die beim Verteidigen ihre absoluten Vorzüge aufweisen können. Und daher können Angriffslinien mit anderen Verteidigungspaaren durchaus mehr Sinn machen als Linien mit fünf Spielern. Man hat so auch mehr Kombinationsmöglichkeiten.
Die Angriffslinien sind meist auf vier Teams aufgeteilt, also auf vier Linien zu drei Stürmer, wobei am Ende des Spieles bei knappem Spielstand nur noch die besten drei Linien aufgeboten werden. Die erste Angriffslinie ist dabei jene mit den stärksten Stürmern, die dritte und vierte Linie jene mit den jüngeren und noch nicht so erfahrenen Spielern.
Road Team oder Gastmannschaft
Generell könnte man annehmen, dass es egal ist, ob man daheim oder auswärts spielt, weil die Spielfläche ist immer gleich, aber so ist es nicht. Der psychologische Effekt der eigenen Fans spielt eine sehr große Rolle, ungeachtet dessen, ob 30.000 Zuschauer im Fußballstadion die Heimmannschaft anfeuern oder 15.000 in großen Eishockeystadion oder ein paar tausend in kleineren Anlagen. Man kennt das Stadion, man kennt die Eigenheiten, das Eis und hat die Fans hinter sich. Ergo geht man davon aus, dass man als Home Team stärker ist und öfter daheim gewinnt als auswärts.
Und daher ist die Mission für das Road Team jene, die Punkte im Meisterschaftsspiel zu stehlen, wobei man anders agiert als zum Beispiel im eigenen Stadion. Da durch das Publikum die Heimmannschaft nach vorne getrieben wird, ist sie offensiver im Aufbau des Spiels und das heißt automatisch, dass man sich als Road Team oder Gastmannschaft vorsichtiger und defensiver aufstellt. Man wartet die Angriffe ab und hofft auf den Scheibenbesitz, um mit schnellen Gegenangriffen zum Torerfolg zu kommen.
Favorit kann auch ein Road Team sein
Es hängt natürlich auch davon ab, wer aufeinander trifft, weil Favoriten werden auch als Road Team versuchen, das Spiel zu dominieren, um keinen Zweifel am Erfolg zuzulassen, aber die Dynamik des Spiels entscheidet häufig darüber, wie die beiden Mannschaften sich verhalten können und sollen. Es ist aber schon so, dass man in der Statistik ablesen kann, wer eher gewinnt - nämlich die Heimmannschaft mit der Unterstützung der eigenen Fans. Zwar hat die Gastmannschaft auch Fans mitgebracht, aber die gehen häufig im Gebrüll der Heimfans unter, was ja auch im Sinne des Erfinders ist, sonst gäbe es keinen Heimvorteil.
Die Bedeutung des Road Teams schwindet aber mit der Bedeutung des Spiels. Im Play-Off gibt es häufig sehr enge Partien, in denen es wesentlicher ist, wer in den entscheidenden Momenten zuschlagen kann als wer Heimvorteil hat. Auch bei großen Turnieren wie den Weltmeisterschaften ist der Heimvorteil nicht immer wesentlich. Technisch gesehen sind dann alle anderen Nationalmannschaften Road Teams, aber die Bedeutung ist so hoch und der Druck auf das Heimteam so stark, dass der Heimvorteil eher zur Belastung wird als zur Stärkung der eigenen Leistung.
Feldspieler
Feldspieler im Eishockeyspiel
Alle Spieler mit Ausnahme des Torwarts
Die Mannschaft im Eishockeyspiel wird mit den unterschiedlichsten Definitionen ausgestattet, wobei es Verteidigungspaare, Angriffslinien, den Torwart und auch als Begriff die Feldspieler gibt. Je nach Situation werden diese Begriffe und Definitionen auch bei Live-Übertragungen und Zusammenfassungen im Fernsehen und in den Radiostationen verwendet.
Was ist ein Feldspieler im Eishockey?
Feldspieler ist im Eishockeyspiel ist ein Begriff, der die gesamte Mannschaft auf dem Eis meint - mit Ausnahme des Torwarts. Jener ist auch der einzige, der stets am Eis präsent ist, während Verteidiger und Angriffsspieler ausgewechselt werden. Und diese Auswechslung findet während des Spiels schnell und für ein kurzes Intervall statt und wird bewusst durchgeführt, wenn es zu einer Situation wie einem Überzahl- oder Unterzahlspiel kommt.
Beim Überzahlspiel wird man die Feldspieler auswählen, die besonders torgefährlich sind und bei einem Unterzahlspiele jene, die im Penaltykilling ausgezeichnet agieren können. Somit kann es sein, dass sämtliche Feldspieler, die aktuell noch am Eis standen, ausgetauscht werden gegen jene Akteure, die nun für den Erfolg sorgen sollen. Feldspieler ist somit ein zusammenfassender Begriff, mit dem schnell dokumentiert ist, dass alle fünf Spieler (oder drei bzw. vier bei Unterzahl) durch ihre Kollegen ausgewechselt wurden.
Aber man bezeichnet mit dem Begriff Feldspieler auch bei der Präsentation des Kaders jeder Mannschaft für das Spiel jene Leute, die von der ersten bis zur vierten Linie für die Position in der Verteidigung oder im Angriff vorgesehen sind. Die Torhüter bleiben stets an ihrem Arbeitsplatz, die Feldspieler können hingegen auch in der Position verändert werden. Ein offensiver Verteidiger kann im Bedarfsfall auch für den Angriff eingesetzt werden, ein Angreifer umgekehrt auch als Verteidiger, wenn es zu einem personellen Engpass kommen sollte.
Enforcer oder Goon
Enforcer oder Goon im Eishockeyspiel
Gut geschützt und doch aktiv
Im Eishockey ist der Torhüter mit der Aufgabe betraut, die gegnerischen Schüsse zu entschärfen, sodass man keine Tore erhält und siegreich das Eis verlassen kann. Da diese mit dem Puck geschossen werden und mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h herangeflogen kommen, braucht der Torhüter einen besonderen Schutz.
Was ist ein Enforcer oder Goon im Eishockeyspiel
Vielfach werden Spieler ausgewählt, die besondere Fähigkeiten haben, sei es beim Tore schießen oder beim Spielaufbau, in der Verteidigung oder durch gute Reflexe als Torhüter. Es gibt aber auch Spieler, die technisch nicht so geeignet sind, aber sie sind groß und stark und die setzt man dann gerne als Enforcer ein, wobei sie auch als Goon bezeichnet werden. Die Hauptaufgabe für solche Spieler besteht vor allem darin, dass sie sich die gefährlichen Gegenspieler zum Ziel machen. Sie provozieren sie, führen harte Checks aus und sie lassen keine Gelegenheit aus, um diese Spieler an ihren Aktionen zu behindern.
Damit ist ein defensiver Zug verbunden, der das Ziel hat, die gegnerische Mannschaft einzuschränken. Wenn ihre wichtigsten Spieler sich nicht entfalten können, kann die ganze Mannschaft nicht so viele offensive Aktionen durchführen und ist weniger gefährlich. Es ist keine sehr feine Strategie, aber eine, die durchaus Anwendung findet.
Enforcer ist der Spieler für's Grobe
Neben der ursächlichen Aufgabe, einen Spieler in seinen Aktionen zu behindern, gibt es auch die Theorie der härteren Gangart. Wenn das Provozieren nicht funktioniert, werden regelwidrige Aktionen ausprobiert und da riskiert man schon einmal zwei Minuten auf der Strafbank, wenn man dadurch dem Gegenspieler Respekt einflößt und er nicht mehr so frei spielen kann, wie er das eigentlich normalerweise zeigen würde. Auch das ist ein Weg. Man kann das noch steigern, indem man Schlägereien beginnt. Das ist dann die höchste Stufe der Provokation und dient dazu, den Spielfluss des Gegners abzustellen. Liegt man hinten und der Gegner greift unentwegt an, kann eine nette Schlägerei dazu dienen, dass man sich selbst erfängt, während der Gegner seinen Angriffselan verliert, bis die Schlägerei beendet ist.
Natürlich kennt man die Spieler, die als Enforcer im Einsatz sind und das Schiedsrichterteam ist dazu angehalten, fiese Aktionen zu unterbinden und spielstarke Mitglieder einer Mannschaft zu schützen. Trotzdem geht die Taktik immer wieder auf, auch wenn sie nicht immer funktioniert.
Eishockey Spiel
(auch Turniere)
Eishockeyspiel und sein Ablauf
Drei Drittel, kein Unentschieden
Es gibt eine ganze Reihe an Begriffe im Eishockeysport für die Verteidigung und für den Angriff, aber wie funktioniert das Eishockeyspiel überhaupt? Im Gegensatz zu einem Fußballspiel gibt es hier kein Unentschieden und die Zeit bleibt stehen, wenn das Spiel unterbrochen wurde - dahingehend gibt es eine Übereinstimmung mit dem Handballsport.
Eishockeyspiel: Unentschieden Fehlanzeige
Das Eishockeyspiel besteht in seiner Grundlage aus drei Spieldrittel, die jeweils 20 Minuten dauern. Diese 20 Minuten sind aber die reine Spielzeit. Das heißt, wenn sich die beiden Mannschaften eine halbe Stunde prügeln - das ist schon vorgekommen - dann ist deshalb ein Drittel noch lange nicht abgeschlossen, weil die Zeit gestoppt wurde. Daher dauert je nach Spiel und Spielweise das Dritte ungefähr 30 bis 40 Minuten. Nach dem Ende des ersten und zweiten Drittels gibt es eine zehnminütige Pause und dann wird das Eis wieder betreten, aber die Mannschaften haben die Seiten getauscht.
Die Pause brauchen die Mannschaften, um sich zu erholen und der Trainer, um die Taktik zu besprechen. Aber sie wird auch benötigt, um das Eis aufbereiten zu können, damit wieder ein professionelles Eishockey möglich ist. Weil mit den zahllosen Bremsmanövern wird die Oberfläche des Eises stark in Mitleidenschaft gezogen und daher wird am Eis gearbeitet, während die Spieler sich von der Anstrengung erholen.
Spielte Team A von links nach rechts in Drittel 1, dann spielt Team A im zweiten von rechts nach links und im dritten wieder so wie im ersten Abschnitt. Die Pause dient dem Trainer dazu, die Spieler auf Fehler aufmerksam zu machen oder bestimmte Spielzüge zu besprechen. Auch Schwachstellen, die beim Gegner aufgefallen sind, werden besprochen, um diese im nächsten Drittel ausnutzen zu können.
Punktevergabe und Entscheidung im Eishockeyspiel
Wie bereits erwähnt, gibt es beim Eishockey kein Unentschieden. Das gab es früher in der Meisterschaft, aber mittlerweile wird eine andere Lösung durchgeführt. Steht es zum Beispiel am Ende des letzten Drittels 4:4, dann gibt es eine Verlängerung. Fällt in der Verlängerung ein Tor, dann ist dieses Tor gleichbedeutend für den Sieg der Mannschaft, die diesen Treffer erzielen konnte. Andernfalls wird ein Penaltyschießen durchgeführt, bis ein Sieger feststeht.
Diese Regelung ist wichtig, denn wenn es zu einer Verlängerung kommt, erhält der spätere Verlierer auf jeden Fall einen Punkt. Hätte er in der regulären Spielzeit verloren, wäre er ohne Punkt dagestanden. Der Sieger in der Verlängerung oder auch im späteren Penaltyschießen bekommt zwei statt der üblichen drei Punkte.
Überblick über die Möglichkeiten
Spielzeit: 3 x 20 Minuten Nettozeit (tatsächliche Spielzeit)
Team A führt 3:2 zum Ende des 3. Drittels
Team A 3 Punkte für den Sieg
Team B 0 Punkte für die Niederlage
Team A gegen Team B steht 3:3, das ergibt eine Verlängerung. In der Verlängerung erzielt Team B ein Tor und gewinnt damit 4:3
Team A erhält einen Punkt für das Erreichen der Verlängerung
Team B erhält zwei Punkte für den Sieg in der Verlängerung
Team A gegen Team B steht nach der Verlängerung noch immer 3:3, Team A siegt im Penaltyschießen
Team A erhält zwei Punkte für den Sieg
Team B erhält einen Punkt für das Erreichen der Verlängerung
Diese Regelungen gelten in der nationalen Meisterschaft genauso wie auch bei den Weltmeisterschaften. Es kann also passieren, dass eine Mannschaft einen Sieg einfährt, aber sechsmal verliert und drei Punkte hat und absteigt, weil eine andere Mannschaft keinen einzigen Sieg, aber dafür vier Niederlagen nach Verlängerung ergo vier Punkte erreicht hat.
Begriffe zu Spiel und Turnier im Eishockey
Puck (Sportgerät im Eishockey)
Beschreibung: Puck
Statistik (viele Details zum Spiel)
Beschreibung: Statistik
Bedeutung des Eishockeysports
Hintergrund: Bedeutung Eishockey
Turniere im Eishockey
ICE Hockey League (internationale Liga mit Österreich)
Beschreibung: ICE Hockey League
Meisterliste der österreichischen Meister
Beschreibung: Meisterliste Österreich
NHL (berühmte Liga in Nordamerika)
Beschreibung: NHL plus NHL Bedeutung und NHL Konferenzen
KHL (osteuropäische Liga)
Beschreibung: KHL
Eishockey-Weltmeisterschaft
Beschreibung: Eishockey-WM und beste Nationalteams im Eishockey
Der Puck
Puck im Eishockeyspiel
Sehr flinkes Spielgerät
Damit es überhaupt ein Eishockeyspiel geben kann, braucht man natürlich die Spielfläche mit der abgrenzenden Bande und der Eisauflage, aber man braucht auch das Spielgerät, das mit den Schlägern bewegt wird - den Puck. Diese kleine Scheibe entscheidet über den Erfolg im Spiel.
Wie groß ist der Puck im Eishockey?
Woraus besteht der Puck eigentlich? Es handelt sich um eine Hartgummischeibe, die 7,62 Zentimeter im Durchmesser groß ist und eine Höhe von 2,54 Zentimeter aufweist. Sie hat ein vorgeschriebenes Gewicht von 156 bis 170 Gramm, womit es eine gewisse Toleranzgrenze bei der Herstellung gibt.
Warum ist der Puck nicht größer? Der Puck muss mit der Schlägerfläche leicht zu treffen sein und ein größerer Puck wäre schwieriger zu steuern und man bräuchte noch mehr Kraft, um einen satten Schuss zeigen zu können. Außerdem würden dann Tore selten fallen, denn wenn man sich das Eishockeytor ansieht und die Größe der Torhüter, wird offenbar, dass das Spielgerät klein sein muss, um überhaupt einen Torerfolg erzielen zu können.
Es ist aber nicht die Dimension alleine das Kriterium, viel mehr ist die Geschwindigkeit das Maß aller Dinge. Ein Verteidiger, der von der blauen Linie auf das Tor schießt, beschleunigt den Puck oftmals auf über 100 km/h. Der Torhüter steht also vor dem Problem, dass etwas sehr Kleines sehr schnell auf ihn zukommt, weshalb seine Reflexe ausgezeichnet funktionieren müssen, um einen Torerfolg des Gegners oder auch der gegnerischen Mannschaft zu unterbinden.
Puck und Schutzmaßnahmen
Dass die Spielfläche eine Bande hat, macht absolut Sinn, denn wenn diese Hartgummischeibe mit 100 km/h oder mehr ins Publikum fliegt, kann das böse Verletzungen zur Folge haben. Aus dem gleichen Grund sind die Spielerinnen und Spieler sehr gut geschützt, vom Helm bis zum Handschuh, vom Beinschützer bis zum Schulterpolster. Das ist natürlich auch eine Schutzmaßnahme bei Stürzen und im harten Zweikampf, aber vor allem auch, um bei Treffer durch den Puck nicht verletzt zu werden. Dass der Torhüter besonders gut geschützt werden muss und die bekannten Torwartschienen als Schutz der Beine trägt, ist daher auch kein Zufall.
Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass der Puck vor dem Spiel in manchen Bewerbsmeisterschaften gekühlt wird. Dadurch fliegt er besser und ist leichter zu steuern, aber dadurch verringert sich auch die Gefahr von Verletzungen, wenn man vom Puck getroffen wurde.
Ganz ungefährlich lebt man im Publikum auch nicht, denn manchmal misslingt ein Schuss einfach oder der Puck wird abgelenkt. Wird er stark abgelenkt, dann fliegt er zwar über die Bande, hat aber weniger Geschwindigkeit. Es gibt aber auch einige, wenn auch seltene Situationen, in denen der Puck mit voller Fahrt die Zuseher erreicht, die sich dann schnell ducken müssen, um nicht getroffen zu werden.
Statistik
Eishockeystatistik bietet zahlen über das Spiel
Statistische Auswertung vom Match bis zur Saison
Besonders in Nordamerika liebt man Sportstatistiken und für jede Bewegung wird nach Möglichkeit eine Statistik geführt. Statistiken gibt es in Europa auch, aber viele leiteten sich mit der Zeit von den US-Vorbildern ab. Besonders intensiv ist die Statistiklust beim Eishockeysport. Dort wird nicht nur erhoben, wie oft auf das Tor geschossen wird, sondern auch, ob der Torwart den Puck fängt oder ob er ihn mit dem Stock abwehrt
Statistik im Eishockeysport
Im Eishockey werden folgende Werte per Statistik erfasst:
- Tore
- Assists
- Punktewertung
- Plus/Minus (oder +/-)
- Spiele
- Eiszeit
- Gegentore
- Saves
Tore und Assists in der Statistik
Pro Spieler werden im Eishockeysport sowohl die Tore als auch die Assists gezählt. Ein Tor ist der tatsächliche Treffer, der Assist ist die Torvorlage, wobei es auch zwei Assistgeber geben kann. Dann haben drei Spieler einen Punkt zusätzlich - die beiden Vorbereiter und der Schütze selbst.
Die Statistik ist insofern interessant, als man pro Spieler erkennen kann, wie erfolgreich dieser gerade oder in einer ganzen Saison ist bzw. war. Während Verteidiger etwa im Fußballspiel durch Kopfballtore nach Eckbällen ab und an ein Tor erzielen, sind die Verteidiger im Eishockey wahre Toresammler, weil sie von der blauen Linie aus viele Weitschusstore erzielen können.
Die Flügelstürmer haben mehr Assists, schießen aber auch viele Tore. Die Mittelstürmer sind bei den Toren höchst erfolgreich, legen aber auch für die Flügelstürmer auf.
Beides - die Tore und die Assists - führen zur Punktewertung. Dabei wird pro Saison oder etwa auch bei einer Weltmeisterschaft eine Rangliste erstellt, die nach Punkteanzahl gereiht ist. Man sieht also sofort, wer die meisten Punkte erreichen konnte.
Diese Punkte sind auch die Grundlage für viele statistische Jubiläen wie etwa der 500. Punkt in der NHL oder das 100. Tor in der Nationalmannschaft.
Bezeichnungen in der Statistik
- T = Tore
- G = Goals
- A oder Ast = Assist
- PP = Powerplay Goal
- SH = Shorthanded Goal
Plus/minus-Statistik
Eine besondere Statistik ist die Plus/Minus-Statistik, die es vor allem im Eishockey gibt. Dabei bekommt jeder Spieler einen Pluspunkt, wenn er bei einem Torerfolg am Eis aktiv gespielt hat und einen Minuspunkt, wenn er bei einem Gegentreffer am Eis war. Ist der Spieler bei drei Toren am Eis, aber bei keinem Gegentor, dann lautet seine Statistik +3 für dieses Spiel.
Die Statistik ist nicht unumstritten, denn es kann ein Stürmer bei Gegentoren nichts dafür und bekommt trotzdem Minuspunkte oder ein Verteidiger ist an den Toren nicht beteiligt und bekommt dennoch Pluspunkte. Da aber die ganze Mannschaft eine Einheit ist und gemeinsam angreift oder verteidigt, kann man schon erkennen, bei welchen Spielern mehr oder weniger Erfolg ermöglicht werden könnte, wenn man dies über einen längeren Zeitraum beobachtet.
Bezeichnung in der Statistik: +/-
Spiele und Eiszeit
Neuer TextEbenfalls pro Eishockeyspieler wird festgestellt, in wie vielen Spielen er eingesetzt wurde und auch, wie lang er auf dem Eis im Einsatz war. Es kann ein junger Spieler zwar in jedem Meisterschaftsspiel im Einsatz sein, aber tatsächlich spielte er im Schnitt nur drei Minuten und das lässt sich mit diesen Werten gut darstellen.
Umgekehrt kann man aber auch erkennen, welche Spieler besonders oft am Eis stehen und das sind meist die wesentlichen Säulen der Mannschaft. Das gilt für sichere Verteidiger ebenso wie auch für sehr torgefährliche Stürmer. Beide setzt man vor allem dann ein, wenn kritische Situationen im Spiel anstehen.
Bezeichnungen in der Statistik
- SP = Spiele absolviert
- GP = games played
- MIN = Minuten gespielt
- MIP = Minutes played
Statistik der Torhüter
Zwei Werte gibt es auch, die die Leistung der Torhüter bekunden. Das eine sind die Gegentore, die ein Torhüter aktiv am Eis einstecken hat müssen. Auch im Eishockey gibt es überwiegend einen vorbestimmten Torhüter, der regelmäßig den Rückhalt in der Verteidigung bildet. Es kann aber auch zwei gleich gute geben, die sich abwechseln und dann kann man mit den Gegentoren einen Vergleich anstellen.
Ein zweiter Wert sind die Saves, wobei es sich um Torhüteraktionen handelt, durch die ein sicheres Tor verhindert werden konnte. Torhüter, die gerade in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und zum Teil wundersame Reaktionen zeigen können, sind sehr gefragt.
Bezeichnungen in der Statistik
- SOG = Shot on Goal / Schüsse auf das Tor
- SVS = Saves / abgewehrte Schüsse
- SVS% = Quote der abgewehrten Schüsse
Bedeutung Eishockey
Eishockey - Eine Reise rund um die Welt
Bedeutung des Eishockeys in den Nationen
Eishockey ist in vielen Ländern der Welt beliebt und wird aktiv gespielt, besonders in Nordamerika und Europa. Der Sport weiß aufgrund seiner Geschwindigkeit, körperlichen Intensität und seiner Fähigkeit, Fans und Spieler gleichermaßen zu begeistern und wurde so eine der aufregendsten Sportarten der Welt.
Faszination Eishockey
Dafür sorgen schon die Schnelligkeit, mit der das Spiel auf dem Eis abläuft. Die Sportler müssen schnell skaten, präzise Pässe schießen und im Idealfall möglichst oft das Tor treffen. Die körperliche Intensität, mit der Eishockey gespielt wird, macht den Sport zu einer intensiven Erfahrung für Spieler und Zuschauer.Dafür sorgen schon die Schnelligkeit, mit der das Spiel auf dem Eis abläuft. Die Sportler müssen schnell skaten, präzise Pässe schießen und im Idealfall möglichst oft das Tor treffen. Die körperliche Intensität, mit der Eishockey gespielt wird, macht den Sport zu einer intensiven Erfahrung für Spieler und Zuschauer.
Der oftmals harte Körperkontakt, dem sich die Spieler ausgesetzt sehen, verstärkt die Spannung zusätzlich. Diese Begeisterung gilt auch für Deutschland, wo zwar König Fußball regiert, doch wo Eishockey immer beliebter wird. Immerhin rund acht Prozent der Bevölkerung lieben den Sport.
Das zeigt sich auch im Wettangebot. Die Sportwetten Anbieter haben zwar viele verschiedene Sportarten im Programm, doch vor allem jene, die Spannung und überraschende Ergebnisse bieten können, sind bei den Kunden sehr gefragt. Die Sportwetten rund um Eishockey nehmen in Deutschland bereits Platz fünf in der Beliebtheitsskala ein, Tendenz steigend. Eishockey Wetten sind besonders für Einsteiger attraktiv, da sie beliebt genug sind, um viele Wettoptionen zu bieten, der Markt jedoch nicht so dicht belagert wie etwa der für Fußballwetten.
Beim Eishockey ist Teamwork gefordert, um die Gegner auszuspielen. Die Action am Eis springt daher schnell auf die Zuschauerränge über. Die Bindung zwischen Publikum und Team ist ausgeprägt, kein Wunder also, dass in den Arenen eine elektrisierende Stimmung herrscht. Dazu kommt in vielen Ländern noch eine lange Tradition, auf die Fans und Mannschaften stolz zurückblicken können. In den folgenden Ländern hat Eishockey einen besonderen Stellenwert erlangt, das zeigt sich auch in den internationalen Erfolgen.

Kanada
Eishockey ist in Kanada der Nationalsport Nr. 1 und hat eine lange Tradition. Kanada ist auch das Land, aus dem das moderne Eishockey stammt. Viele Kanadier haben Eishockey als Hobby und spielen es in ihrer Freizeit. Die National Hockey League (NHL) ist die wichtigste professionelle Eishockeyliga in Nordamerika und umfasst neben den Mannschaften aus den USA auch zahlreiche kanadische Teams. International ist Kanada Rekordweltmeister zusammen mit der UdSSR/Russland, beispielsweise gewannen die Kanadier im Jahr 2021.
USA
Der große Nachbar im Süden ist ebenso verrückt nach Eishockey, wie die Kanadier. Hier spielt man besonders in den nordöstlichen Bundesstaaten und in Kalifornien. Die NHL ist nicht nur die größte, sondern auch die wichtigste Liga der Welt. Jeder Spieler, der eine große internationale Karriere anstrebt, möchte eines Tages in der NHL spielen. Angesichts dieser enormen Konkurrenz und der finanziellen Mittel, die in den USA bereitstehen, ist es ein wenig überraschend, dass die USA bisher erst zweimal Eishockey-Weltmeister wurden. Der letzte Titel liegt schon länger zurück und wurde im Jahr 1960 erobert.
Russland
Russland teilt sich mit Kanada den Titel der weltweit erfolgreichsten Nation im Eishockey. Das russische Nationalteam konnte bisher ebenfalls 27 Titel erringen. Doch die Spieler waren Spätstarter, ihr Siegeszug begann erst im Jahr 1954. Zwischen 1978 und 1990 gewann die Mannschaft nicht weniger als acht Titel. Diese Mannschaft beherrschte das Spiel in Perfektion und wurde daher als „Rote Maschine“ bezeichnet. Die höchste nationale Liga ist die Kontinentale Hockey-Liga (KHL). Daran nehmen auch Mannschaften aus Europa und Asien teil.
Skandinavien
Der Weltmeister 2022 kam jedoch nicht aus Kanada oder Russland, sondern aus Finnland. Nach zwei Weltmeistertiteln und insgesamt elf Silbermedaillen zählen die Finnen zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Das kommt nicht überraschend, schließlich wird der Sport in Schweden, Finnland und Norwegen oft im Freien ausgeübt. Das Klima begünstigt die Sportler bei ihrem Training. Viele Spieler aus diesen Ländern sind auch in der NHL aktiv. Nachbar Schweden verbuchte bisher elf Weltmeistertitel auf seinem Konto.
Tschechien und die Slowakei
Auch in Osteuropa hat Eishockey eine lange Tradition und ist sehr populär. Dabei stechen vor allem Tschechien und die Slowakei hervor. Die Slowakei gewann 2002 ihren ersten Titel, Nachbar Tschechien zählt mit insgesamt zwölf WM-Titel zu den erfolgreichen Teams der Welt. Zwischen 1999 und 2001 gelang den Spielern sogar das Kunststück von drei Siegen hintereinander.
Begeisterung auch in wärmeren Gefielen
Doch es muss in einem Land nicht immer kalt sein, um die Begeisterung für Eishockey zu wecken. So hat der Sport beispielsweise in Japan stark an Popularität gewonnen. Japan hat sowohl eine professionelle Eishockeyliga, die Japan Ice Hockey League, als auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft.
Ähnliches gilt sinngemäß auch für Südkorea. Dies ist auf die Teilnahme Südkoreas an den Olympischen Winterspielen 2018 zurückzuführen, bei denen sie eine starke Leistung zeigten. Südkorea hat ebenfalls eine professionelle Eishockeyliga, die Asia League Ice Hockey.
China profitierte ebenfalls von der Teilnahme an Olympischen Winterspielen. Nach dem Event 2022 im eigenen Land, spielen immer mehr Chinesen Eishockey. Das zeigt sich auch an der Popularität der professionellen Eishockeyliga, der Chinese Ice Hockey League.
Sogar die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine eigene Eishockeymannschaft, die in der asiatischen Eishockeyliga spielt. In wärmeren Ländern wird zumeist in klimatisierten Hallen gespielt, die entsprechende Bedingungen simulieren. Das beweist, dass der Liebe zum Eishockey in vielen Ländern keine Grenzen gesetzt sind.
Ice Hockey League
bet-at-home Ice Hockey League statt EBEL
Internationale Meisterschaft mit Schwerpunkt Österreich
Seit dem Jahr 1923 wird in Österreich um den Titel im Eishockey gespielt, auch wenn es bis zu den 1960er-Jahren dauerte, ehe die Meisterschaft auf professionelle Basis gestellt werden konnte. Seither gab es verschiedene Titelträger, der Rekordmeister heißt aber unbestritten KAC aus Klagenfurt.
Im Jahr 2003 wurde ein neuer Hauptsponsor für die Eishockeymeisterschaft gefunden, und zwar die Erste Bank. Aus der Meisterschaft wurde wie bei vielen Sportverbänden und -events in Österreich ein neuer Titel, wobei sich in diesem Fall aber auch ein neues Konzept etablieren konnte. Die Meisterschaft wurde zur Erste Bank Eishockey Liga. Nach dem Verlassen des Sponsors wurde daraus die bet-at-home ICE Hockey League.
Erste Bank Eishockey Liga seit 2003/04
Konkret starteten in die Saison 2003/04 sieben Vereine und stellte damit noch die klassische Eishockeymeisterschaft im alten Stil dar. In dieser Zeit gab es jede Menge finanzielle Probleme bei den Vereinen und aus der Not wurde eine Tugend gemacht, denn mit Jesenice aus Slowenien wurde der erste Verein aus dem Ausland in die Meisterschaft integriert. Damit waren acht Vereine vertreten, doch dies war erst der erste Schritt. Punktesysteme wurden eingeführt, um die Flut teurer Legionäre einzudämmen und auch junge Spieler an die Kampfmannschaften der Vereine heranzuführen. So sollte auch die Nationalmannschaft unterstützt werden.
EBEL wird International
Die Erste Bank Eishockey Liga, die meist einfach EBEL abgekürzt wird, wurde sportlich immer interessanter. Damit meldeten weitere Vereine ihr Interesse an. Österreichische Vereine wie Innsbruck kamen in die höchste Spielklasse zurück, nachdem sie sich in die Nationalliga verabschiedet hatten. Dornbirn spielte auch in der obersten Liga mit und Vereine aus Kroatien, Slowenien, Ungarn und sogar auch Tschechien fanden den Weg in die EBEL, die auf 12 Vereine aufgestockt werden konnte.
Damit ist man keine NHL, aber man hat ein Produkt anzubieten, das international beachtet wird und das den Konkurrenzkampf noch weiter schürt. In mancher Saison sind die österreichischen Vereine klar dominant, in anderen Spielzeiten gibt es kaum österreichische Vereine im Halbfinale. Österreichischer Meister wird daher nicht der EBEL-Sieger, sondern der beste österreichische Verein. Sollte es also ein ausländisches Finale geben, dann wird hier der EBEL-Sieger gesucht, der österreichische Meister wird dann wohl im Halbfinale zu finden sein.
Gespielt wird in der Erste Bank Eishockey Liga zuerst ein langer Grunddurchgang und dann eine Zwischenrunde. Je nach Zahl der Vereine kann der Modus wechseln. Bei zuletzt 12 Vereinen spielen die besten sechs des Grunddurchgangs um die besten vier Plätze in der Zwischenrunde, denn dann kann man den Gegner für das Viertelfinale in der Reihenfolge auswählen. Also der Sieger der Zwischenrunde zuerst und der Vierte muss nehmen, was kommt.
Die anderen sechs Vereine spielen um die verbliebenen zwei Plätze für das Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale gibt es die K.o.-Duelle, wie man sie von der NHL auch kennt.
Neuerung ab 2025/16: Punktesysstem
Die EBEL verpasste sich per Saison 2015/16 ein Punktesystem, wie es zum Beispiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft auch Anwendung findet. Das heißt, dass es für einen Sieg in der regulären Spielzeit drei statt zwei Punkte gibt, gewinnt man nach Verlängerung oder Penalty-Schießen, gibt es zwei Punkte und der Verlierer erhält dann einen Punkt. Verliert man in der regulären Spielzeit, steigt man weiterhin mit null Punkte aus.
ICE hockey League als neuer Name
Nachdem die Erste Bank als Sponsor ausgestiegen ist, änderte sich der Name der Liga in "bet-at-home ICE Hockey League". Geändert hat sich am Modus aber nichts, es bleibt weiter die internationale Liga mit den österreichischen Vereinen.
https://www.ice.hockey/Nachdem die Erste Bank als Sponsor ausgestiegen ist, änderte sich der Name der Liga in "bet-at-home ICE Hockey League". Geändert hat sich am Modus aber nichts, es bleibt weiter die internationale Liga mit den österreichischen Vereinen.
Meisterliste Östereich
Eishockey Meister in Östereich
Meisterliste seit der ersten Eishockeymeisterschaft 1923
Seit der Zwischenkriegszeit wird in Österreich die Eishockey-Meisterschaft ausgetragen. Bereits 1923 wurde der erste Meister ermittelt. Rekordmeister sind die Kärntner vom KAC. In den letzten Jahren führt der Weg über den Meistertitel allerdings meist über die Mannschaft von Red Bull Salzburg.
Meisterschaft und ICE hockey League
(ehemals EBEL)
Der österreichische Meistertitel wurde lange Jahre in einer üblichen Meisterschaft ermittelt, also mit Grunddurchgang und einem Play-Off bis zum Finale der besten beiden Teams. Seit 2003/04 gibt es in Österreich aber das Konzept der EBEL, der Erste Bank Eishockey Liga. Damit wurde nicht nur die Meisterschaft entsorgt, sondern auch ein internationales Format geschaffen, bei dem mal mehr und mal weniger Vereine aus Österreich und den Nachbarländern von Ungarn bis Italien, von Tschechien bis zur Slowakei mitwirken.
Es kann daher passieren und ist schon passiert, dass im Finale der EBEL zwei ausländische Vereine stehen und der österreichische Meistertitel bereits davor entschieden wurde. Meistens ist der österreichische Meister aber auch der Sieger der EBEL und in den letzten Jahren war beides durch Red Bull Salzburg gegeben.
Das zeigt auch die Liste der Meister, denn die Salzburger haben mit natürlich guten finanziellen Möglichkeiten und starker Mannschaft vielfach den Titel holen können. Seit 2007 waren nur der KAC und die Linzer in der Lage, diese Reihe zu durchbrechen, ansonsten ging der Titel stets nach Salzburg.
Geändert hat sich das erst 2017, als die Vienna Capitals nach 2005 wieder einmal den Titel geholt haben. Allerdings war dies ein bemerkenswerter, weil zuerst ein Punkterekord im Grunddurchgang erzielt wurde und dann holte man im Viertelfinale, Halbfinale sowie im Finale mit 4:0 Siegen das Maximum heraus und wurde die erste Eishockeymannschaft, die mit 12:0 Play-Off-Siegen den Titel einfahren konnte.
2020 gab es die nächste Besonderheit, aber weniger auf sportlicher Ebene. Der Coronovirus hat notwendig gemacht, dass im Viertelfinale der EBEL der Spielbetrieb abgebrochen werden musste und damit konnte auch kein Meister ermittelt werden. Außerdem wurde der Sponsor gewechselt und so wurde aus der EBEL die bet-at-home ICE Hockey League. Doch wie in Österreichs Sport öfter, gab es auch danach Änderungen, etwa beim Namen zur win2day ICE Liga.
Liste der Östereichischen Meister
2025 Red Bull Salzburg
2024 Red Bull Salzburg
2023 Red Bull Salzburg
2022 Red Bull Salzburg
2021 KACC
2020 kein Meister ermittelt - wegen Coronaviru
2019 KAC
2018 Red Bull Salzburg
2017 Vienna Capitals
2016 Red Bull Salzburg
2015 Red Bull Salzburg
2014 Red Bull Salzburg
2013 KAC
2012 Black Wings Linz
2011 Red Bull Salzburg
2010 Red Bull Salzburg
2009 KAC
2008 Red Bull Salzburg
2007 Red Bull Salzburg
2006 Villacher SV
2005 Vienna Capitals
2004 KAC
2003 Black Wings Linz
2002 Villacher SV
2001 KAC
2000 KAC
1999 Villacher SV
1998 VEU Feldkirch
1997 VEU Feldkirch
1996 VEU Feldkirch
1995 VEU Feldkirch
1994 VEU Feldkirch
1993 Villacher SV
1992 Villacher SV
1991 KAC
1990 VEU Feldkirch
1989 Innsbruck
1988 KAC
1987 KAC
1986 KAC
1985 KAC
1984 VEU Feldkirch
1983 VEU Feldkirch
1982 VEU Feldkirch
1981 Villacher SV
1980 KAC
1979 KAC
1978 ATSE Graz
1977 KAC
1976 KAC
1975 ATSE Graz
1974 KAC
1973 KAC
1972 KAC
1971 KAC
1970 KAC
1969 KAC
1968 KACC
1967 KAC
1966 KAC
1965 KAC
1964 KAC
1963 Innsbruck
1962 WEV
1961 Innsbruck
1960 KAC
1959 Innsbruck
1958 Innsbruck
1957 EK Engelmann
1956 EK Engelmann
1955 KAC
1954 Innsbruck
1953 Innsbruck
1952 KAC
1951 Wiener Eissport-Gemeinschaft
1950 Wiener Eissport-Gemeinschaft
1949 Wiener Eissport-Gemeinschaft
1948 WEV
1947 WEV
1946 EK Engelmann
1938 EK Engelmann
1937 WEVV
1935 KAC
1934 KAC
1933 WEVV
1932 Pötzleinsdorfer SK
1931 WEVV
1930 WEV
1929 WEV
1928 WEV
1927 WEV
1926 WEV
1925 WEV
1924 WEV
1923 WEV
NHL- plus Bedeutung & Konferenzen
NHL und ihre Geschichte
National Hockey League wurde globales Sportereignis
Die Geschichte der NHL ist eine sehr bewegte Geschichte. Mit vielen Höhepunkten und Wendungen, die zur Gründung sicherlich niemand vorhergesehen hat.
Wie alles begann -
Der Start der wichtigsten Hockeyliga der Welt
Als im Jahr 1917 die National Hockey League – kurz NHL – in Nordamerika gegründet wurde, ging es recht bescheiden und überschaubar zu. Hockey war auch im hohen Norden von Amerika noch kein Breitensport und die Gründungsväter begaben sich auf fremdes Terrain.
Mit fünf Mannschaften wurde die Liga gestartet. Zu diesen Mannschaften gehörten die Ottawa Senators, die Quebec Bulldogs, die Montreal Wanderers und die Canadians de Montreal. Etwas später kamen noch die Toronto Arenas hinzu.
Zwischen den Jahren 1943 und 1967 spielten ganze sechs Teams in der NHL, die auch heute noch in der Liga präsent sind. Die sogenannten „Original Six“, wie sie in Fachkreisen genannt werden, sind die traditionsreichsten Teams in der Liga. Zu diesen Teams gehören die Boston Bruins, die Detroit Red Wings, die Montreal Canadiens, die New York Rangers, die Toronto Maple Leafs sowie die Chicago Blackhawks.
1967 expandierte die NHL. Sechs Mannschaften wurden hinzugenommen. Inzwischen sind das alles Zahlen, die mit der heutigen Liga nicht mehr vergleichbar sind. Die NHL besteht aus 32 Teams, die aus Kanada und den USA kommen. Die USA stellen 25 Teams, Kanada 7 Teams. Gespielt wird jährlich um den sogenannten Stanley- Cup. Er wurde nach dem Generalgouverneur von Kanada, Frederick Arthur Stanley, benannt. Ein großer Eishockey-Fan, der die Liga von Beginn an unterstützt hat.
Die NHL gilt heute als die beste und stärkste Eishockey-Liga der Welt. Absolute Rekordmeister sind die Canadians de Montréal, die 24-mal den Titel geholt haben. Mehrere TV-Partner übertragen die Spiele live in Kanada sowie in den USA. Als erfolgreichster Spieler gilt Henry Richard, der 11-mal den Stanley-Cup mit den Montreal de Canadiens gewonnen hat. Der erfolgreichste Torschütze ist Wayne Gretzky, der 894 Tore und 2857 Punkte in der regulären Saison erzielt hat. Steve Yzerman war der längste Mannschaftskapitän, der in der Geschichte der NHL verzeichnet wurde. Von 1986 bis 2006 war er der Mannschaftskapitän der Detroit Red Wings. Und Martin Brodeur ist der einzige Torwart, der 600 Siege verzeichnen kann. Ein Rekord, den sicherlich so schnell keiner knacken wird.
Der Saisonablauf in der NHL
Die NHL unterscheidet zwischen dem der regulären Saison und den Play-offs. In der regulären Saison spielt jedes Team insgesamt 82 Spiele. Eine große Anzahl, die auf das komplizierte System und die Einteilung zurückzuführen ist. Allerdings ist diese hohe Anzahl an Spielen auch eine Chance. Für die Fans bedeutet sie, dass viele Spiele gesehen werden können. Die Mannschaften haben die Möglichkeit, sich im Laufe der Saison zu entwickeln und durch die vielen Spiele auch viele Punkte zu sammeln.
Die Spiele sind in unterschiedlichen Bereichen zu finden. Unterteilt sind sie in die Eastern Conference und die Western Conference. Es gibt immer ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel. Zusätzlich werden 29 Spiele pro Team in der eigenen Division gespielt.
Wurden alle 82 Spiele von jedem Team bestritten, dann erfolgt eine getrennte Berechnung der Eastern Conference und der Western Conference. Aus den beiden Divisionen werden die drei punktbesten Mannschaften herausgesucht. Sie haben sich automatisch für die Play-offs qualifiziert.
Zusätzlich wird die Vergabe von zwei Wildcards vorgenommen. Diese Wildcards gehen an die Teams, die neben den bereits qualifizierten Teams die meisten Punkte haben. Die Vergabe der Wildcards erfolgt divisionsübergreifend. Dadurch kann es passieren, dass eine Division fünf Teams und die andere Division nur drei Teams in die Play-off-Runde schickt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Fünftplatzierte in der einen Division mehr Punkte hat als der Viertplatzierte der in der anderen Division.
Insgesamt stehen somit 8 Mannschaften in den Play-offs, bei denen der „Best of Seven“ Modus gespielt wird. Die Mannschaft, die zuerst den 4. Sieg erreicht hat, kommt automatisch in die nächste Runde. Die Paarungen werden immer divisionsintern über die erreichten Punkte festgelegt. Der Punktbeste spielt dabei gegen das Wildcard Team und die zweite Mannschaft gegen die dritte Mannschaft. Wenn zwei Wildcards an die gleiche Division ausgegeben wurden, spielt das schlechtere Wildcard Team gegen den besseren Ersten aus den beiden Divisionen.
Nach einer Runde wird das Divisionsfinale gespielt, bei dem es darum geht, die besten Teams der Divisionen zu ermitteln. Es folgt das Conference- Finale, wo die Divisionssieger aufeinandertreffen. Die besten Mannschaften aus diesen Spielen treffen sich dann im Stanley-Cup Finale und spielen um den Saisonsieg.
All dies wirkt für Außenstehende etwas unübersichtlich. Wer sich mit Eishockey jedoch beschäftigt und die NHL Ergebnisse ein wenig beobachtet, wird den Modus und den Saisonablauf relativ schnell verstehen. Denn die NHL bietet ihren Fans viele Spiele und Highlights, die Eishockey sehr interessant machen und dafür sorgen, dass es auch heute noch zu den beliebtesten Sportarten in Kanada und Amerika gehört. In Kanada ist die NHL die beliebteste Liga. In den USA liegt sie ebenfalls sehr weit vorne. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
Ein kleiner finanzieller Einblick
Sport und in diesem Fall Eishockey gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Kein Wunder, dass die NHL so beliebt ist und einen gigantischen Umsatz macht.
Die NHL hat beispielsweise in der Saison 2017/2018 mit nur 31 teilnehmenden Teams einen Gesamtumsatz von 4,152 Milliarden Euro gemacht. Rechnet man dies auf alle Teams um, ist das ein Umsatz pro Team von knapp 134 Millionen Euro. Inzwischen sind es 32 Teams, was die Wertigkeit der Liga noch einmal deutlich erhöht.
Zu den umsatzstärksten Teams in der NHL gehören die New York Rangers. Sie machen pro Jahr etwa 225 Millionen US-Dollar Umsatz. Dagegen wirken die 156 Millionen US-Dollar der Vegas Golden Knights schon deutlich bescheidener.
Letztendlich sind das aber nur Zahlen, die über die Qualität in der Liga nichts aussagen. Denn diese gigantischen Werte werden hauptsächlich durch Werbeeinnahmen und den Verkauf verschiedener Rechte generiert. Wichtig ist, dass die Fans die Liga lieben, dass die Spieler eine gute Arbeit leisten und so dafür sorgen, dass auch in Zukunft mit der NHL zu rechnen ist. Und davon kann ausgegangen werden.Sport und in diesem Fall Eishockey gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Kein Wunder, dass die NHL so beliebt ist und einen gigantischen Umsatz macht.
Die NHL hat beispielsweise in der Saison 2017/2018 mit nur 31 teilnehmenden Teams einen Gesamtumsatz von 4,152 Milliarden Euro gemacht. Rechnet man dies auf alle Teams um, ist das ein Umsatz pro Team von knapp 134 Millionen Euro. Inzwischen sind es 32 Teams, was die Wertigkeit der Liga noch einmal deutlich erhöht.
Zu den umsatzstärksten Teams in der NHL gehören die New York Rangers. Sie machen pro Jahr etwa 225 Millionen US-Dollar Umsatz. Dagegen wirken die 156 Millionen US-Dollar der Vegas Golden Knights schon deutlich bescheidener.
Letztendlich sind das aber nur Zahlen, die über die Qualität in der Liga nichts aussagen. Denn diese gigantischen Werte werden hauptsächlich durch Werbeeinnahmen und den Verkauf verschiedener Rechte generiert. Wichtig ist, dass die Fans die Liga lieben, dass die Spieler eine gute Arbeit leisten und so dafür sorgen, dass auch in Zukunft mit der NHL zu rechnen ist. Und davon kann ausgegangen werden.
KHL
KHL - Das russische Pedant im Eishockey
Kontinental Hockey League in Europa
Eishockey ist mit Russland ebenso eng verknüpft wie der Wodka, eine große Gastfreundschaft und die unendliche Weite Sibiriens. Die höchste Spielklasse im Eishockey ist in Russland die KHL - die Kontinentale Hockey Liga, die international unter der englischen Bezeichnung „Kontinental Hockey League“ vermarktet wird. In dieser höchsten Spielklasse Russlands sind nicht nur Mannschaften aus Russland vertreten, sondern auch Teams aus europäischen sowie asiatischen Staaten. Der Gewinner dieser Liga erhält am Ende der Spielsaison den Gagarin-Pokal. Namensgeber ist hier der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin.
Die Geschichte Der KHL
Ähnlich wie die NHL hat die KHL eine recht bewegte Gründungsphase. Sie ist allerdings nicht ansatzweise so alt wie die NHL und muss sich deshalb auch eine deutlich kürzere Geschichte fokussieren.
Die KHL wurde in der Saison 2008/2009 gegründet. Sie löste damals die sogenannte Superliga ab. Beim Start der KHL waren 24 Mannschaften aus 4 Ländern vertreten. Inzwischen ist das Feld etwas bunter und besteht aus Ländern, die im eurasischen Raum angesiedelt sind. Dazu gehören die Länder Kasachstan, Lettland, Russland, Kroatien, Slowakei, Finnland, Tschechien, Belarus und die Ukraine. In der Premierensaison spielten von den 24 Teilnehmern bereits 20 Mannschaften in der Superliga. Hinzu kamen noch die Mannschaften aus Minsk und aus Riga sowie zwei Mannschaften, die vor der Saison am Spielbetrieb der Wysschaja Liga teilgenommen haben.
Bereits im Laufe der ersten Spielsaison wurde für die nächste Saison 2009/2010 mit 30 Mannschaften geplant. Dazu gehörten schwedische Top-Clubs ebenso wie finnische Clubs oder Clubs aus Tschechien, der Ukraine und aus Deutschland. Die Eisbären Berlin waren eine Mannschaft, die in der Saison 2009/2010 in der KHL vertreten sein sollten.
Letztendlich kam es doch etwas anders. Aus der geplanten Expansion zur nächsten Saison ist nichts geworden. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten wurde letztendlich nur eine Mannschaft aufgenommen. Erst in der Saison 2010/2011 ging die Expansion weiter und sorgte dafür, dass die Liga gewachsen ist. Doch es gab immer wieder finanzielle Probleme, sodass es letztendlich zu Ausschlüssen von Mannschaften, aber auch zur Verkleinerung der gesamten Liga kam. Ab dem Jahr 2018 wurde die Ligastärke auf 24 Teilnehmer begrenzt. Welche Klubs das sind, erfolgt aufgrund der Auswahl nach einem Punktesystem, bei dem es um sportliche Leistungen, Stadionauslastung, Finanzierung durch öffentliche Stellen sowie Ausgaben geht.
Trotz der Verkleinerung ist es den Organisatoren wichtig, dass asiatische wie auch europäische Clubs in die Liga aufgenommen werden. Um das zu garantieren, werden zwei bestehende Clubs aus dem Punktesystem ausgeschlossen. Und das jährlich, um eine gewisse Rotation bezüglich neuer Clubs und neuer Anreize für die Liga zu schaffen.
Der Spielmodus bei der KHL
Die reguläre Saison beginnt mit einem Eröffnungsspiel, das die beiden Vorjahresfinalisten austragen. Der sogenannte Lokomotive-Pokal wird hier ausgespielt. Aktuell muss im Anschluss jede Mannschaft insgesamt 60 Spiele bestreiten.
Dazu gehören 24 Spiele gegen die jeweils anderen sechs Teams der eigenen Division. Hier werden immer zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele gespielt. Hinzu kommen 14 Spiele, die gegen Teams der anderen Division der Konferenz gespielt werden. Es handelt sich jeweils um ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel. Außerdem 14 Spiele gegen Teams einer anderen Konferenz, wobei es sich hier um 7 Heimspiele und 7 Auswärtsspiele handelt. Zu guter Letzt kommen 4 weiteren Spiele hinzu. Und zwar gegen Teams, die in der eigenen Konferenz sind und gegen Teams, die aus einer anderen Konferenz stammen. Berücksichtigt werden bei diesen 4 Spielen immer regionale und logistische Aspekte.
Nach den Spielen gewinnt immer die Mannschaft mit den meisten Punkten die reguläre Saison und erhält den Kontinental-Pokal. Damit ist die Saison jedoch noch nicht vollständig beendet.
Im Anschluss an die normale Saison werden die Playoffs gespielt. Aus beiden Konferenzen werden hierfür die punktbesten acht Mannschaften herausgezogen. Die Sieger der Divisionen werden dabei auf die ersten vier Positionen der Setzliste gesetzt.
Gespielt wird seit der Saison 2010/2011 im Modus „Best-of-seven“. Wer die Finalserie gewinnt, ist der Gewinner des Gagarin-Pokals.
Die KHL gilt als neue Größe im Welteishockey
Das russische Eishockey wird im Gegensatz zum Fußball nicht von den bekannten Moskauer Vereinen dominiert. Favoriten sind vielmehr Mannschaften aus St. Petersburg, aus Omsk, Ufa oder Kasan. Aktuell sind mehrere nicht russische Teams in der KHL zu finden. Es handelt sich hierbei um Mannschaften aus Kasachstan, China, Belarus, Lettland und Finnland. Eine deutsche Mannschaft ist nicht vertreten.
Auch wenn die KHL als wichtige Konstante im Eishockey betrachtet wird, gilt es abzuwarten, wie sich die Liga entwickelt. Aufgrund der Tatsache, dass sie noch recht jung ist, muss der richtige Weg mit Sicherheit erst gefunden werden. Finanzielle Engpässe und die richtige Zusammensetzung der Teams müssen geklärt werden. Letztendlich sorgt das aller dafür, dass die Liga stets spannend bleibt und viele interessante Ansätze bietet. Auch dann, wenn man sich beispielsweise mit Sportwetten beschäftigt.
Was geht im Bezug in der KHL?
Sportwetten sind sehr beliebt und funktionieren selbstverständlich auch bei der Kontinental Hockey League. Alle großen Sportwettenanbieter haben entsprechende Wetten platziert, sodass sogar ein Sportwetten Bonus genutzt werden kann.
Gewettet wird wie bei der NHL oder anderen Ligen auf die jeweiligen Ausgänge der Spiele sowie die verschiedenen Konstellationen. Auch Kombiwetten sind möglich, was die Quote deutlich anhebt.
Das Besondere bei der KHL ist die Tatsache, dass sich die Liga noch sehr im Umbruch befindet. Es gibt noch keine Mannschaften, die sich besonders herauskristallisieren und die als treibende Kraft gelten. Deshalb sind besonders Sportwetten bei dieser Liga ausgesprochen spannend. Denn Trends lassen sich nicht wirklich vorhersagen. Und das sorgt für gute Quoten und für gute Gewinne.
Behalten wir also die KHL im Auge und schauen uns an, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickelt. Es gibt viel Potenzial und es wird mit Sicherheit einige Veränderungen geben. Wichtig ist, dass die Liga Bestand hat und dass sie noch mehr an Stärke gewinnt. Dann ist sie ein würdiger Konkurrent zur NHL und wird auch viele starke Clubs hervorbringen. Allerdings bedarf es noch ein paar Saisons, bis der komplette Weg erkennbar ist.
Eishockey-WM und beste Nationalteams im Eishockey
Eishockey-WM oder Eishockey-Weltmeisterschaft
Größtes Eishockey-Turnier für Nationalmannschaften
Im Eishockeysport gibt es zwei wesentliche Herausforderungen, nämlich den Erfolg auf Klubebene und jenem für die Nationalmannschaft, wobei je nach Land eine unterschiedliche Gewichtung stattfindet. Ein US-amerikanischer oder kanadischer Eishockeyspieler verzichtet gerne auf die Eishockey-WM, wenn er in der NHL um den Stanley-Cup mitkämpfen kann. Ein österreichischer Eishockeyspieler würde auch lieber um diesen begehrten Pokal spielen, kommt aber selten zu dieser Ehre und ist daher meist für das Nationalteam im Einsatz
Modus der Eishockey-Weltmeisterschaft
Die Eishockey-WM gibt es seit den 1920er-Jahren, genau genommen seit exakt dem Jahr 1920. Damals wurde ein Turnier mit allen Teilnehmern ausgetragen und der Sieger war Kanada und damit der erste Weltmeister. Seither hat sich die Zahl der interessierten Nationalmannschaften aber so erweitert, dass ein Turnier nicht möglich ist. Daher wurde über viele Jahre und Jahrzehnte ein Modus mit A bis D gespielt, wobei in der A-WM die besten Nationalmannschaften um den echten Titel gespielt haben, von der B- bis zur D-WM ging es darum, aufzusteigen und auf keinen Fall abzusteigen.
Österreich war und ist eine Mannschaft, die ganz gerne in die höchste Klasse aufsteigt, aber sich postwendend von dort per Abstieg wieder verabschiedet. Per 2001 wurde die Weltmeisterschaft verändert, indem aus der A-WM die Top Division wurde und darunter gibt es die Division I mit zwei Gruppen zu sechs Nationalmannschaften, was ähnlich eingestuft ist wie die ehemalige B-WM sowie die Division II mit ebenfalls zweimal sechs Nationalmannschaften und als unterste Klasse gibt es die Division III mit einer Gruppe zu sechs Teams.
Der offizielle Weltmeister wird weiterhin in der obersten Klasse ausgespielt, aber im Gegensatz zu der früheren A-WM nicht mit vier Gruppen und dann einer Zwischenrunde, sondern mit zwei Gruppen zu acht Nationalmannschaften, wobei die besten vier in das Viertelfinale aufsteigen und von dort an geht es im K.o.-Modus bis zum Finale. Die Letzten der beiden Gruppen sind die Absteiger und werden durch die Aufsteiger der Division I im nächsten Jahr ersetzt.
Bedeutung der Eishockey-WM
Bereits eingangs wurde erwähnt, dass nicht für jeden Spieler der WM-Titel das Höchste ist. Neben dem WM-Titel ist der Stanley-Cup ein großes Thema und auch der Olympiasieg mit der Nationalmannschaft bei den olympischen Winterspielen. Nur wenige Spieler konnten alle drei Titel zumindest einmal einfahren, denn zum Beispiel im Team Kanada spielen oft junge Leute von kleineren Klubs, die es nicht in das Play-Off der NHL schaffen konnten. Die Stars sind dort im Einsatz, während bei der Weltmeisterschaft um den Titel gespielt wird.
Dennoch ist der WM-Titel von Bedeutung, wobei die politische Komponente wegfällt. Zu Zeiten des Kalten Krieges war die Auseinandersetzung der Teams der UdSSR und Kanada nicht nur sportlich brisant, heute ist mit Russland immer noch ein starker Gegner gegeben, aber es geht rein um den sportlichen Erfolg, nicht um irgendwelche politischen Hintergründe.
Die üblichen Verdächtigen beim Ausspielen der Weltmeisterschaft sind und bleiben wohl Russland und Kanada, stark agieren zudem Schweden und Tschechien, Außenseiter sind meist Finnland und die USA. Es kann aber auch ganz anders kommen, denn die Schweiz stand auch 2013 im Finale, womit niemand gerechnet hatte. Als die Schweiz 2018 erneut im Finale stand, war das keine so große Überraschung mehr.
Liste der Eishockey-WM
Bis zum Jahr 1968 galt das olympische Turnier als Eishockey-Weltmeisterschaft, sodass der Olympiasieger auch der Weltmeister im Eishockey war. Das Turnier im Rahmen der olympischen Spiele von 1920 galt daher als erste Weltmeisterschaft. In den 1980er-Jahren gab es keine Weltmeisterschaft im Eishockey, wenn in dem Jahr olympische Spiele ausgetragen wurden.
Mittlerweile gibt es aber jedes Jahr eine Weltmeisterschaft im Eishockey und kann auch im Olympia-Jahr als Revanche dienen, wenn das olympische Turnier nicht so erfolgreich verlaufen ist. Ein Blick auf die Weltmeister der letzten Jahre zeigt aber auch, dass zwar immer die gleichen Verdächtigen um den Titel spielen, aber es nicht so einfach ist, Seriensiege zu erzielen, wie es einst der UdSSR gelungen war.
Erstaunlich war, dass Tschechien lange Jahre nicht mehr im Finale war, 2024 aber den Heimtitel holen konnte. Noch erstaunlicher war der Titelgewinn der USA 2025, denn obwohl man öfter die Bronzemedaille gewann, war die USA 1960 das letzte Mal in einem Finale (damals gleichzeitig Olympiasieger). Und die Schweiz hat seit 2013 viermal das Finale erreicht, aber der Titel will nicht gelingen.
Eishockey-Weltmeister seit 1920
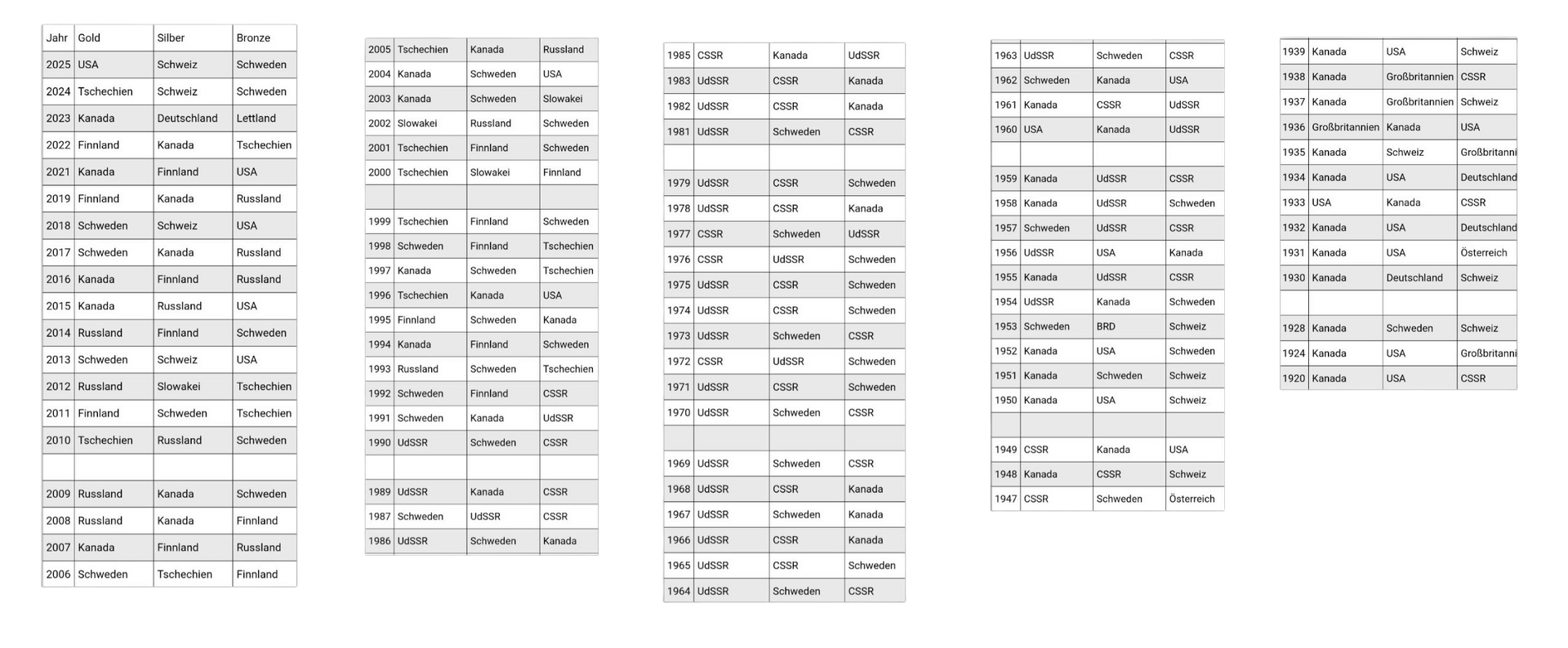
Strafen
Strafen im Eishockeyspiel
Strafen und Strafkatalog im Eishockeyspiel
Beim Eishockey ist die Grenze zwischen erlaubtem Körpereinsatz wie dem Body-Check und unerlaubten Angriff auf den Gegner sehr fließend. Die Handlungen sind sehr schnell durchgeführt und in der Hitze des Gefechts, erst recht, wenn das Spiel auf des Messers Schneide steht, kann es schon vorkommen, dass man auf seine Disziplin vergisst und das hat Strafen zur Folge, die die eigene Mannschaft massiv schwächen können.
Strafenkatalog im Eishockeyspiel
Der Eishockeysport lebt davon, dass es dynamisch zur Sache geht. Damit ist einerseits die Spielgeschwindigkeit und der rasche Wechsel der Spielsituationen gemeint, andererseits aber auch die Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein. Man darf den Gegner checken, abdrängen und am Spielfluss hindern, aber es gibt einen Katalog an unerlaubten Aktionen, die zu Strafen führen können.
Der Sinn dieses Katalogs besteht darin, schwere Verletzungen zu vermeiden und eine sportlich faire Veranstaltung zu ermöglichen. Natürlich gibt es immer wieder hitzige Gefechte und auch so manche Boxeinlage, die die Zuschauer auch meist äußerst unterhaltsam finden, aber wenn man mit dem Stock einen Gegner am Kopf trifft, ist das weniger lustig und kann üble Folgen haben.
Daher gibt es eine Aufstellung, was erlaubt ist und was nicht, wobei die Situationen eigentlich klar sein sollten. Wenn man einen Gegner checkt und in an die Bande drückt, ist das eine Sache. Der Gegner sieht das kommen und stellt sich darauf ein. Wenn er aber von hinten gegen die Bande gedrückt wird, ist das ganz etwas anderes, weil er das nicht hat sehen können und so auch falsch reagieren könnte, Verletzungsgefahr inklusive.
Nachstehend werden typische Strafen, wie sie beim Eishockey immer wieder vorkommen, grob umschrieben. Die nachstehenden Unterseiten gehen noch näher darauf ein.
Cross-Check
Neuer TDer Cross-Check ist ein Check in den Körper des Gegners, der nicht mit dem Körper durchgeführt wird wie beim erlaubten Body-Check, sondern mit dem Eishockey-Schläger in waagrechter Position, also beispielsweise auf Brusthöhe, wodurch der Gegner gegen die Bande gedrückt werden kann. Der Cross-Check wird mit einer Strafe von zwei Minuten geahndet, die auf der Strafbank zu verbüßen ist.ext
Behinderung
Der Regelverstoß Behinderung wird in den meisten Fällen dann geahndet, wenn der gegnerische Spieler die Chance hatte, ein Tor zu erzielen oder seinen Mitspieler in eine günstige Position zu bringen, um den Torschuss zu wagen. Die Behinderung ist dann gegeben, wenn man durch Sperren des gegnerischen Schlägers oder ähnliche Aktionen versucht zu verhindern, dass die Aktion gelingt. Behinderung wird mit zwei Minuten auf der Strafbank bestraft.
Hoher Stock
(gefährliches Spiel)
Wenn ein Spieler im Rahmen eines Spielzuges beim Eishockey den Schläger mit der Schlägerschaufel hoch über dem Kopf führt, ist das an sich noch kein Foul, aber es kann jemand im Gesicht getroffen werden, weshalb eine Strafe ausgesprochen wird, die zwei Minuten auf der Strafbank bedeutet.
Beinstellen
Wenn dem gegnerischen Spieler das Bein gestellt wird, sodass er zu Boden geht, gibt es auch zwei Minuten auf der Strafbank. Handelt es sich dabei um eine Aktion, bei der der Gegner alleine auf das Tor zugefahren ist, kann auch ein Penalty verhängt werden. In dem Fall muss der gefoulte Spieler versuchen, den Tormann auszutricksen und beim Strafstoß (Penalty) ein Tor zu schießen.
Zum Beinstellen gibt es aber noch den Begriff der Schwalbe, die man vor allem durch den Fußballsport sehr gut kennt. Auch im Eishockey kann ein Spieler sehr leicht fallen - in der Hoffnung auf Strafe für den Gegner. Aber das kann auch per TV-Beweis überprüft werden und funktioniert nicht so gut wie bei so manchem Fußballspiel.
Ellenbogen-Check
Der Check von Mann zu Mann, um an den Puck zu kommen, ist noch kein Vergehen. Wenn man aber den Ellbogen ausfährt, fährt man umgehend für zwei Minuten auf die Strafbank.
Härtere Strafen
Neben den genannten Strafen gibt es noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, die zuletzt auch erweitert wurden. Bereits genannt ist die Strafe, wenn man einen Check in den Rücken des Gegners durchführt, auch Checks gegen den Kopf werden bestraft, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren.
An sich harmlose Fouls, die auch nicht böse Absicht waren, können für eine Mannschaft dramatische Folgen haben, wenn Blut fließt. Wenn beispielsweise ein Foul mit dem Stock verübt wurde, sind zwei Minuten auf der Strafbank fällig, was noch nichts Besonderes ist. Wenn aber der Gegner dabei eine Verletzung, zum Beispiel im Gesicht, davongetragen hat, bei der er blutet, gibt es zumindest eine zusätzliche Fünf-Minuten-Strafe, wobei das Verhängnisvolle daran ist, dass diese fünf Minuten voll genommen werden.
Bei einer Zwei-Minuten-Strafe verfällt die Strafe, wenn die gegnerische Mannschaft in Überzahl ein Tor geschossen hat. Bei einer Fünf-Minuten-Strafe ist dies nicht der Fall, das bedeutet, dass die eigene Mannschaft auf jeden Fall voll fünf Minuten in Unterzahl spielen muss und das kann fatale Folgen für den Spielausgang haben.
Über die Fünf-Minuten-Strafe hinaus gibt es auch die Zehn-Minuten-Strafe oder ein Spieler kann wegen eines schweren Vergehens für das gesamte Spiel ausgeschlossen werden. In besonders schweren Fällen folgt eine Matchsperre für einige Spiele. Das ist meistens dann der Fall, wenn der Gegner schwer verletzt wurde.
Begriffe zu den Strafen im Eishockey
Schiedsrichterteam (zeigen Strafen per Handzeichen an)
Beschreibung: Schiedsrichter oder Linienrichter und Handzeichen
2-Minuten-Strafe (übliches Strafausmaß)
Beschreibung: 2-Minuten-Strafe
5-Minuten-Strafe (gar nicht gut für das Team)
Beschreibung: 5-Minuten-Strafe
Aufgeschobene Strafe (Strafe, aber nicht gleich)
Beschreibung: aufgeschobene Strafe
Disziplinarstrafe (für böse Buben)
Beschreibung: Disziplinarstrafe
Übertriebene Härte (nach Schlägerei)
Beschreibung: Übertriebene Härte
Beinstellen (nicht erlaubt)
Beschreibung: Beinstellen
Haken (böser Einsatz des Stocks)
Beschreibung: Haken
Cross Check und Stockschlag (gefährlicher Stockeinsatz)
Beschreibung: Cross Check oder Stockschlag
Halten (Gegner zurückhalten)
Beschreibung: Halten
Zeitverzögerung (Puck absichtlich entsorgen)
Beschreibung: Zeitverzögerung
Schiedsrichter oder Linienrichter und Handzeichen
Schieds- und Linienrichter im Eishockeyspiel
Die On-Ice-Officials und die Off-Ice-Officials
Ein Eishockeyspiel ist ein schnelles und dynamisches Spiel zweier Mannschaften und braucht Regeln, die auch exekutiert werden, wenn man sich nicht an solche hält. Im Eishockeysport ist dies die Aufgabe sowohl von den sogenannten On-Ice-Officials als auch von den Off-Ice-Officials. Die On-Ice-Officials sind vor allem Schiedsrichter und Linienrichter, also meist englisch ausgedrückt Referee und Linesman, wobei das übliche System 1-2 gilt, also ein Schiedsrichter und zwei Linesman. Dieses System wird immer öfter mit 2-2 aufgewertet.
Schieds- und Linienrichter im Eishockeyspiel
Der Schiedsrichter ist der Chef am Platz und trifft die finale Entscheidung, der Linienrichter hat die Aufgabe, die Bullys durchzuführen und Regelverstöße anzuzeigen, er darf aber auch mit der Pfeife das Spiel anhalten, wenn eine Verletzung droht, das Tor aus der Verankerung gerissen wurde oder andere Handlungen auffallen, die gefährlich werden könnten oder bei denen die Regeln vorsätzlich nicht beachtet werden.
Viele Jahre hat der Schiedsrichter mit zwei Linienrichter das Spiel geleitet, aber immer öfter kommt ein zweiter Schiedsrichter zum Einsatz. Er hat die gleiche Wertigkeit wie sein Kollege und damit ist die noch schneller gewordene Spielweise unter einem weiteren Augenpaar zu erfolgen. Damit sollen Fehler, aber auch Vergehen noch deutlicher erkannt werden können.
Insgesamt spricht man bei dem System von einem 4-Offizielle-System (4 officials system), das bisherige Modell ist das 3-Offizielle System (3 officials system). In Sonderfällen ist es auch zulässig, den anderen Weg einzuschlagen und zwar mit zwei Mann (two-on-ice), wobei beide sowohl Schiedsrichter als auch Linienrichter sind.
Zusammenarbeit im Schiedsrichterteam
Der Schiedsrichter wird auch als Hauptschiedsrichter bezeichnet und entscheidet über die verschiedenen Handlungen, Situationen und auch Strafen. Bei zwei Schiedsrichter haben beide das Recht, den Off-Ice-Offiziellen anzuzeigen, zu welcher Entscheidung sie gekommen sind, wenn es zu einer Strafe kommt. Der Kapitän einer Mannschaft darf mit dem Schiedsrichter über die Entscheidung sprechen, aber nur der Kapitän. Einen Dialog mit dem Trainer gibt es durchaus auch hin und wieder, aber alle anderen Spieler und Mannschaftsmitglieder haben keinen Kontakt zum Schiedsrichter.
Der Schiedsrichter oder auch Referee kann sich von den Linienrichtern oder meist englisch bezeichnet Linesmen beraten lassen. Ist unklar, ob ein Foul gegeben war, kann sowohl über ein Headset als auch über das direkte Gespräch das Gesehene ausgetauscht werden. Die Linesmen sind für das Bully zuständig, sie klären, ob ein Abseits vorliegt und zeigen Vergehen an, die der Schiedsrichter dann pfeift und ahndet.
Außerdem kann es Hilfestellung bei großen Turnieren geben, wenn es ein Videosystem gibt, das klären kann, ob der Puck hinter der Torlinie war oder nicht. Bei Weltmeisterschaften ist es schon öfter vorgekommen, dass erst das Video Klarheit schaffen konnte, ob ein Tor vorliegt oder nicht. Es gab aber auch schon Fälle, in denen nicht einmal die Videoanalyse geholfen hat.
Off-Ice-Officials oder die Offiziellen abseits der Eisfläche
Verschiedene weitere Aufgaben gibt es je nach Art und Dimension von Spiel und/oder Turnier. Dazu gehören zwei Strafbankbetreuer, Spielzeitnehmer und Strafzeitnehmer, ein Stadionsprecher und bei großen Turnieren ein Punktrichter sowie der Kollege, der die Videos der Toraufnahmen überprüft und das Ergebnis dem Schiedsrichter mitteilt.
Handzeichen der Schiedsrichter im Eishockeyspiel
Was bedeuten die verschiedenen Armsignale?
Wie bei allen Sportarten gibt es auch im Eishockeyspiel Schiedsrichter, und zwar zumindest einen Schiedsrichter und zwei Linesman, die unterstützen und die Bullys durchführen. Wesentlich für die Kommunikation auch für den Hallensprecher und die Durchführung der Regeln ist die Kommunikation.
Damit der Schiedsrichter nicht wegen jeder Aktion zur Bande fahren muss, um seine Entscheidung bekannt zugeben, gibt es die in den weltweit gültigen Regeln festgelegten Handzeichen, die international als Referee Signals bezeichnet werden. Sie sind eindeutig und man weiß ohne einem gesprochenen Wort, was gemeint ist.
Nur bei Unklarheiten oder etwa beim Rückfragen der Videokontrolle etwa bei der Frage Tor oder nicht Tor gibt es eine längere Diskussion.
2-Minuten Strafen
(übliches Strafmaß)
2-Minuten Strafe im Eishockeyspiel
Die übliche Strafe im Eishockey
Wenn ein Spieler im Eishockeymatch eine Unsportlichkeit begeht, dann gibt es für diesen Spieler eine Strafe, die üblicherweise als 2-Minuten-Strafe ausgesprochen wird. Das bedeutet, dass der Spieler für zwei Minuten echte Spielzeit nicht zur Verfügung steht und auf der Strafbank Platz nehmen muss.
Was ist die 2-Minuten Strafe
Neuer TextBei üblichen Fouls, wie sie oft im Eishockey vorkommen können, gibt es eine 2-Minuten-Strafe. Das heißt, dass der Übeltäter für zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen muss. Mehr noch - er darf auch nicht ersetzt werden, sodass die eigene Mannschaft in eine Unterzahl gerät und mit vielen Angriffen des Gegners rechnen muss, der das Powerplay beginnt. Das Powerplay ist eine Spielsituation, in der eine Mannschaft einen Spieler mehr als die andere hat und dem geht immer eine Strafe voraus.
Noch schlimmer wird die Situation, wenn ein zweiter Spieler bestraft wird, weil dann sitzen zwei Spieler auf der Strafbank und der Gegner hat eine 5 gegen 3-Übermacht auf dem Eis und eine riesige Chance, ein Tor zu erzielen. Es kann aber auch sein, dass der Gegner auch einen Spieler verliert und es eine 4 gegen 3-Spielsituation gibt. Deshalb muss man besonders vorsichtig sein, wenn schon ein Spieler bestraft wurde, aber manchmal kann sich eine klar unterlegene Mannschaft nur noch mit Fouls helfen.
Bedeutung der 2-Minuten Strafe
Die 2-Minuten-Strafe ist das klassische Strafausmaß für einen Spieler, wenn er sich mit seinem Schläger beim Gegner eingehängt hat, um diesen unerlaubt zu stoppen oder wenn dem Gegner die Beine weggezogen werden. Auch der Stockschlag oder der Cross-Check sind übliche Strafen, für die man als Konsequenz die Strafbank besuchen muss.
Sind die zwei Minuten um, dann darf der Spieler wieder auf die Eisfläche zurückkehren und mitwirken. Wobei es sich aber nicht um zwei normale Minuten handelt, sondern um zwei Minuten echte Spielzeit. Also bei einer Spielunterbrechung läuft die Zeit nicht weiter, sondern hält auch bei der Strafe an, sodass man wirklich vollständige zwei Minuten des Spielgeschehens verpasst. Erzielt die Gegenmannschaft in der Zeit ein Tor, dann darf man frühzeitig das Eis wieder betreten und die Strafe ist erledigt.
Es kann daher auch sein, dass man nur acht Sekunden auf der Strafbank Platz nimmt, weil der Gegner sofort ein Tor erzielen kann.
Weitere Strafen
Begeht man aber eine strafbare Handlung, bei der der Gegner so verletzt wird, dass er blutet, dann wird aus der 2-Minuten-Strafe eine 5-Minuten-Strafe. Das ist verhängnisvoll, weil der Spieler wirklich fünf Minuten draußen bleiben muss, und zwar auch dann, wenn der Gegner bereits ein Tor erzielt hatte.
Die 2-Minuten-Strafe kann auch ergänzt werden. Bei schwereren Vergehen kann es 2 + 2-Minuten-Strafe geben, auch 2 + 10 Minuten ist je nach Vorgang möglich. Neben der Strafe gegen einen Spieler gibt es auch die Strafe gegen die Mannschaft, vor allem dann, wenn es einen Wechselfehler gab und ein Mann zu viel auf dem Eis steht. Ein Spieler muss dann stellvertretend für die Mannschaft zwei Minuten auf die Strafbank.
5-Minuten Strafen
(garnicht gur für das Team)
5-Minuten Strafe im Eishockeyspiel
Keine Aufhebung nach einem Tor
Neben der 2-Minuten-Strafe im Eishockeyspiel, die man für ein Vergehen ausfassen kann und die man auf der Strafbank abzusitzen hat, gibt es als höhere Strafe die 5-Minuten-Strafe. Der Unterschied ist, dass für die gleiche Handlung drei weitere Minuten an Strafzeit ausgesprochen werden, wenn sich der Gegner verletzt.
Unterzahl für echte 5 Minuten
Wenn man mit dem Schläger einen Haken produziert und sich dabei beim Gegner einhängt, um ihn entgegen der Spielregeln zu stoppen, dann gibt es dafür zwei Minuten, also die 2-Minuten-Strafe. Das ist ein Schutz, weil der Schläger in der Höhe nichts verloren hat und für gefährliche Situationen sorgen kann. Wenn bei der Aktion der Schläger den Gegner auch noch verletzt und er blutet, dann gibt es fix fünf Minuten Strafe - manchmal bei besonders schweren Vergehen werden auch zehn Minuten ausgesprochen.
Fünf Minuten Strafzeit oder auch als 5-Minuten-Strafe genannt ist aber durchaus üblich und bedeuten nicht nur, dass man statt zwei fünf Minuten des Spiels auf der Strafbank Platz nehmen muss und in Echtzeit verliert, sondern es bedeutet auch Verhängnisvolles für das eigene Team. Dieses muss nicht nur mit einem Spieler weniger auskommen, es muss dies fünf Minuten lang bewältigen. Denn bei der 2-Minuten-Strafe wird die Strafe aufgehoben, wenn die zwei Minuten vorbei sind oder wenn davor der Gegner ein Tor erzielen konnte.
Bei der 5-Minuten-Strafe ist das Verhängnisvolle die Tatsache, dass ein Tor gar nichts ändert. Der Gegner bleibt in Überzahl und eine gute Power Play Mannschaft kann auch zwei oder drei Tore erzielen und die Überzahlsituation ausnutzen. Genau deshalb ist die 5-Minuten-Strafe eine große Gefahr für jede Mannschaft im Eishockeysport. Zwei Minuten kann man irgendwie über die Zeit bringen und die Situation retten, aber fünf Minuten lang in Unterzahl zu spielen, ist eine große Herausforderung, die nur selten gut geht, weil man stets unter Druck steht.
Verhängnisvolle Strafe
Natürlich ist es einfacher, wenn der Gegner nicht über die spielerischen Mittel verfügt, aber innerhalb von fünf Minuten fällt auch durchschnittlichen Mannschaften eine Idee ein, wie sie einen Angriff durchziehen können. Neben der Unsportlichkeit ist die 5-Minuten-Strafe auch im Hinblick auf diese Gefahr unbedingt zu vermeiden.
Außerdem macht man den Gegner sauer, wenn man deren Mitspieler verletzt hat. Wenn das obendrein ein wichtiger Spieler etwa für den Spielaufbau ist oder ein sehr erfolgreicher Torschütze, dann könnte man das auch als Absicht interpretieren und dann ist man noch zorniger. Aber die Strafe passiert schon einmal, wenn es hektisch zugeht, doch sie sollte die Ausnahme sein. Kein Spieler soll sich verletzen und bluten.
Manchmal passiert es, dass man beim Umdrehen den Stock in der Höhe hat und den Gegner trifft, den man gar nicht gesehen hatte, meist wollte man aber einen Gegner bewusst angreifen, aber nicht so, dass man dafür fünf Minuten kassiert.
Etliche Spiele sind auf diese Art und Weise entschieden worden. Man lag 0:1 zurück, ein Mitspieler wurde am Kopf getroffen und blutete und in den fünf Minuten in Überzahl hat man das Spiel auf 3:1 gedreht und letztlich gewonnen, was ohne dieser Strafzeit vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre.
Aufgeschobene Strafe
(Strafe, aber nicht gleich)
Aufgeschobene Strafe im Eishockeyspiel
Verschieben der Strafe
Wenn während eines Eishockeyspiels eine Regelwidrigkeit festgestellt wird, wird nicht wie bei anderen Sportarten die Aktion sofort unterbrochen, sondern es kommt zum Fall der aufgeschobenen Strafe. Das heißt, dass die Aktion weiterläuft, und zwar so lange, bis ein Spieler der betroffenen Mannschaft den Puck berührt.
Was ist die aufgeschobene Strafe im Eishockey?
Die aufgeschobene Strafe im Eishockeyspiel ist immer dann der Fall, wenn die Strafe nicht sofort ausgesprochen wird. Angenommen ein Spieler stellt einem Gegenspieler das Bein und dieser fällt hin, dann ist dies ein klarer Fall für eine 2-Minuten-Strafe und wird als Beinstellen ausgesprochen. Aber diese Erkenntnis übermittelt der Referee (Schiedsrichter) nicht sofort, sondern wartet die laufende Aktion ab. Dabei hebt einer der Referees den rechten Arm und zeigt damit die Strafe an, das Spiel läuft aber weiter. Die Gegenmannschaft kann nun den Torhüter vom Eis nehmen und einen zusätzlichen Feldspieler einsetzen, um die Überzahl auf 6 gegen 5 zu erhöhen, denn beim Berühren des Pucks durch die bestrafte Mannschaft wird das Spiel sofort abgepfiffen.
Es kann also nicht passieren, dass diese Mannschaft ins leere Tor schießt, weshalb es auch keine Gefahr für das Herausnehmen des Torwarts gibt. Diese Situation der aufgeschobenen Strafe wird immer wieder praktiziert, um die Überzahl schnell auszunutzen. Pfeift der Referee schließlich ab, dann wird die Strafe wie gehabt ausgesprochen und der betroffene Spieler findet sich auf der Strafbank ein. Im Falle höherer Strafen kann es auch sein, dass er die Kabine aufsuchen muss, weil er ausgeschlossen wurde.
Die aufgeschobene Strafe ist ein weiterer Faktor, der zeigt, wie dynamisch das Eishockeyspiel durchgeführt wird. Bei anderen Sportarten wird gleich abgepfiffen, beim Eishockey wird sofort darauf reagiert und eine noch aggressivere Angriffsaktion versucht. Daher ist es auch wichtig, dass das Team als Ganzes gut funktioniert und sofort jeder weiß, was er zu tun hat. Wenn der Torwart am Fleck stehen bleibt, kann man diese überraschende Aktion gleich wieder vergessen. Er muss genauso schnell reagieren wie auch der Trainer, der einen zusätzlichen Feldspieler aufs Eis schickt.
Disziplinarstrafe
(für böse Buben)
Disziplinarstrafe im Eishockeyspiel
10 Minuten Strafzeit oder gar länger
Wird ein Foul im Eishockey durchgeführt, dann gibt es eine Strafe von normalerweise zwei Minuten auf der Strafbank. Die größere Strafe sind fünf Minuten, die fatal für eine Mannschaft sein können, weil sie auch nicht aufgehoben wird, wenn der Gegner ein Tor erzielen konnte. Noch länger dauert die Disziplinarstrafe.
Wann gibt eine Disziplinarstrafe im Eishockey?
Eine Disziplinarstrafe wird dann vom Referee (Schiedsrichter) ausgesprochen, wenn ein besonders schweres Vergehen geahndet wird. Das kann zum Beispiel ein Schlag mit dem Schläger zwischen die Beine oder eine besonders brutale Aktion anderer Art sein. Auch Raufbolde, die sich minutenlang am Eis prügeln, können eine solche Strafe ausfassen. Die Disziplinarstrafe kann verschiedene Ebenen aufweisen.
Üblicherweise erhält man als Spieler zehn Minuten Strafzeit als Disziplinarstrafe. Häufig wird diese als 2 + 10 Minuten ausgesprochen, was bedeutet, dass das Team zwei Minuten mit einem Mann weniger auskommen muss, danach gilt die 10-minütige Strafe für den Spieler, ohne dass das Team in Unterzahl spielen muss. Der Spieler darf nicht mitwirken, das Team agiert wie gehabt mit fünf Spielern.
Die nächste Ebene ist die Dauerdisziplinarstrafe, die aussagt, dass der Spieler das Eis und den Spielbereich verlassen muss, und zwar bis zum Ende des Spiels. Er ist damit für den Rest des Matches nicht mehr spielberechtigt. Dies kann noch durch die Matchstrafe erweitert werden. In dem Fall ist man auch ausgeschlossen, aber zusätzlich kann man sich auf ein Spiel Sperre Minimum einstellen. Das heißt, man darf das Spiel nicht nur nicht zu Ende spielen, sondern bekommt eine zusätzliche Sperre ausgesprochen, wobei es nicht bei einem Spiel bleiben muss. Hat man ein besonders schweres Foul begangen, dann sind vier oder mehr Spiele auch als Sperre möglich.
Ursache der Disziplinarstrafe
Diese Strafen werden dann ausgesprochen, wenn man sich besonders gefährlich verhalten hat oder wenn man den Gegner gar verletzt hatte. Sie sind als Drohung stets im Raum und sollen die gefährlichen Situationen in den Zweikämpfen eindämmen, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Es kann hektisch zugehen, es können Spiele sehr knapp verlaufen, aber man darf das Fairplay niemals verlassen.
Nun gibt es Spieler, die eigens dafür aufgestellt werden, um wichtigen Gegenspielern auf die Zehen zu steigen, also sie an der Spielentfaltung tunlichst zu hindern. Aber das darf zu keiner Verletzung führen und manchmal braucht ein Spieler einfach Zeit, um Dampf ablassen zu können. Zehn Minuten auf der Strafbank sind eine sehr effektive Möglichkeit nach einer illustren Prügelei am Eis.
Interessanterweise ist diese Strafe für die Mannschaft ungefährlicher als die 5-Minuten-Strafe, bei der man wirklich die gesamte Dauer über mit einem Mann weniger auskommen muss. Meist gibt es die 2+10-Strafe und dann ist man die üblichen zwei Minuten in Unterzahl, die restlichen zehn Minuten betreffen nur den einen Spieler und ein Spielmacher muss schon Amok laufen, um sich so eine Strafe einzuhandeln. Es sind eher die bekannten Raufbolde, die eine solche Strafe riskieren.
Übertriebene Härte
(nach Schlägerei)
Übertriebene Härte im Eishockeyspiel
2-Minuten-Strafe zum Abkühlen
Neben den klaren Strafen wie Stockschlag oder Crosscheck gibt es auch Grenzfälle im Eishockeysport und dazu zählt die Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern. Das Salz in der Suppe aus Sicht vieler Eishockeyfans ist eine intensive Begegnung von zwei Teams, bei denen auch schon einmal die Fäuste fliegen können, wenn die Emotionen nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden.
Wann führt Übertriebene Härte zur Strafe?
Kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern, ist es eine Auslegungssache, was der Schiedsrichter (Referee) damit anzustellen gedenkt. Er kann die Streithähne trennen und das Spiel geht wie gehabt weiter, er kann aber auch eine kleine Bankstrafe aussprechen, also eine 2-Minuten-Strafe und als Begründung wird dann übertriebene Härte angeführt oder zu englisch Roughing. Wann eine Strafe erfolgt und wann nicht, ist Auslegungssache.
Es hat schon Spiele bei Weltmeisterschaften gegeben, bei denen man sich gewundert hat, wie viele solcher Aktionen nicht bestraft wurden und andere, bei denen simplere Aktionen bestraft wurden. Das hängt auch vom Schiedsrichterteam ab, aber generell kommt es natürlich darauf an, wie brutal vorgegangen wird und ob sich die Spieler gleich beruhigen oder ob sie versuchen, ein wenig Boxtraining zu zeigen. Wer sich überhaupt nicht beruhigen kann, findet sich automatisch auf der Strafbank wieder, um dort seine Emotionen zu glätten. Meist ist es bei dieser Strafe so, dass zwei Spieler die Strafbank aufsuchen - von jeder Mannschaft ein Stück, denn zum Streiten gehören bekanntlich zwei.
Worum es im Streit und in der Auseinandersetzung überhaupt gegangen ist, ist dabei nicht so wesentlich. Typisch für das Eishockeyspiel ist aber eine Situation, nämlich jene zum Schutz des Torhüters. Wenn ein Torhüter von einem gegnerischen Spieler mit dem Stock attackiert wird, bekommt er sofort eine Lektion, denn der Torhüter wird beschützt - nicht nur von den Regeln und der Ausrüstung, sondern auch von seinen Mitspielern, die sich den Kerl sofort vorknöpfen, der es wagt, ihren Goalie anzugreifen. Größtenteils sind es ein paar Schubser, aber manche Spieler gehen dann ruppig vor und das kann eine Strafzeit bedeuten.
Beinstellen
(nicht erlaubt)
Strafe wegen Beinstellen im Eishockeyspiel
Den Gegner zu Fall bringen
Verschiedene Unsportlichkeiten können beim Eishockey zu einer 2-Minuten-Strafe führen und eine dieser Möglichkeiten ist das Beinstellen, das man vom Fußball her auch kennt. Im Eishockey gibt es zwei Möglichkeiten, um dies durchzuführen, nämlich durch die eigenen Beine wie beim Fußball, was aber technisch eher schwierig ist oder durch Einsatz des Stockes, wodurch man den Gegner zu Fall bringt.
Beinstellen im Eishockey
Hauptsächlich wird ein Gegenspieler absichtlich oder unabsichtlich mittels Stock von der Eisfläche befreit. Man zieht ihm die Beine weg und er fliegt mit seinem ganzen Körper auf das Eis. Das kann passieren, weil man etwas unglücklich mit dem Stock hantiert hat und in der schnellen Bewegung die Beine des Gegners getroffen hat, es kann aber auch Absicht sein, um den Angriff zu unterbinden. Gerade bei einem schnellen Konterangriff ist man in den Mitteln eingeschränkt, wenn der Gegner einen Vorsprung hat und eine große Torchance vorfinden könnte.
Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob man eine Strafe riskieren soll, doch in manchen Situationen macht dies durchaus Sinn, weil die Unterzahl kann man vielleicht ohne Gegentreffer überstehen, die aktuelle Situation wird aber so bewertet, dass ein Tor fast nicht zu verhindern ist - außer mit einem Foul.
Das Beinstellen ist aber eine etwas schwierige Situation, weil der Gegner auch damit spekuliert und gerne zu Fall kommt, um ein Überzahlspiel zu provozieren. Die bekannte Schwalbe gibt es auch im Eishockeysport, wenngleich sie im Fußballspiel häufiger anzutreffen ist. Daher ist es für den Schiedsrichter manchmal schwierig zu erkennen, ob nun wirklich Absicht vorgelegen hatte oder der Gegenspieler mitgeholfen hat, dass es zu diesem "Foul" kommen konnte.
Beinstellen bringt 2 Minuten
Jedenfalls wird dieses Foul üblicherweise mit einer Strafe von zwei Minuten auf der Strafbank geahndet. Das Gefahrenmoment ist bei diesem Foul geringer als bei einem hohen Stock, weil das Gesicht normalerweise nicht verletzt werden kann, aber dennoch kann beim Sturz eine Verletzung auftreten. Schon alleine deshalb sollen die Situationen unterbunden werden und werden als Foul interpretiert und mit der Strafe belegt, damit sie selten vorkommen.
In der Hitze des Gefechts wird aber immer wieder ein Gegner zu Fall gebracht, um ihn zu stoppen oder einen gefährlichen Gegenangriff zu unterbinden, der zu einem Gegentreffer führen könnte.
Haken
(böser Einsatz des Stocks)
Strafe wegen Haken im Eishockeyspiel
Zu hohes Spiel mit dem Eishockeystock
Der Stock ist das Werkzeug im Eishockeyspiel und in der Bewegung ist der Stock auch an anderer Stelle zu finden als auf der Eisfläche, weil man dann schneller laufen kann. Man hebt ihn hoch und führt in der Luft, um ihn nach einem Pass zu nutzen, damit der Puck weitergespielt werden kann.
Was ist der Haken im Eishockeyspiel?
Dabei kann es aber passieren, dass man den Stock nicht nur hebt und schneller läuft, sondern ihn auch in Richtung Gegenspieler bewegt, um sich bei diesem einzuhängen. Damit hält man ihn auf, was sehr praktisch ist und gerade bei einem schnellen Gegenangriff wie dem Konter ist diese Taktik brauchbar, aber sie ist nicht erlaubt. Mit dem Stock kann man schnell einen Spieler verletzen und deshalb wird die Aktion mit einer Strafe von zwei Minuten geahndet.
Es ist nicht immer Absicht dahinter, wenn ein Haken vom Schiedsrichter gepfiffen wird, aber manchmal ist es bewusste Absicht, um einen Gegenspieler aufzuhalten, der sonst zu enteilen droht. Er stürzt meist auf das Eis und die Angriffsgefahr ist unterbunden, aber die eigene Mannschaft ist dann auch geschwächt und man findet sich auf der Strafbank wieder.
Haken ist normalerweise keine so aggressive Handlung wie zum Beispiel der Crosscheck, bei dem man den Stock bewusst gegen den Oberkörper des Gegenspielers einsetzt, aber es ist eine gefährliche Aktion. Denn wenn der Stock nicht die Beine trifft, sondern etwas höher geführt wird, kann das Gesicht verletzt werden. Es gibt zwar den Gesichtsschutz, doch dieser ist nicht immer die Garantie für den Schutz, vor allem dann nicht, wenn man mit dem Stock getroffen wird.
Haken und die 5-Minuten Strafe
Gerade nach einem Haken kann es auch eine längere Strafe geben, weil man den Gegner mit dem Stock verletzt hat. Es gibt die Grundregel, dass aus der 2-Minuten-Strafe eine 5-Minuten-Strafe wird, wenn der Gegenspieler aufgrund der Aktion blutet, aber diese Regel trifft nicht immer zu. Auch ohne einen Tropfen Blut kann die Strafe verlängert werden. Für die eigene Mannschaft ist dies fatal, weil man dann fünf Minuten in Unterzahl spielen muss und es auch keine Aufhebung nach einem Gegentreffer gibt. Bei der 2-Minuten-Strafe ist der bestrafte Mitspieler nach einem Gegentor wieder zur Verfügung und man ist vollzählig.
Die Strafe ist durchaus sinnvoll, weil die Verletzungsgefahr größer ist als bei anderen Fouls wie dem Beinstellen. Man führt den Stock von hinten und kann auch schwer abschätzen, welche Bewegung der Gegenspieler durchführt, deshalb kann es zu wirklich ernsthaften Verletzungen kommen.
Cross-Check oder Stockschlag
(gefährlicher Stockeinsatz)
Cross-Check im Eishockeyspiel
Unerlaubte Aktion mit dem Schläger mit 2-Min-Strafe
Crosscheck zählt zu den bekannten Foulmöglichkeiten im Eishockeyspiel und wird mit dem Stock ausgeführt. Es kann dabei zu einer gefährlichen Situation mit Verletzungsrisiko kommen und deshalb wird die Aktion durch eine Strafe von normalerweise zwei Minuten vom Referee (Schiedsrichter) geahndet.
Was ist der Crosscheck?
Der Crosscheck ist eine Bewegung zum Körper des Gegners, bei der man den Stock auf Brusthöhe mit beiden Händen hält und mit dem Stock den Gegner gegen die Bande drückt. Der Crosscheck ist auch in der Eismitte möglich, wenn man den Gegner wegdrückt. Der Gegenhalt der Bande ist dann aber nicht gegeben. Die Aktion ist gefährlich und wird daher mit einer 2-Minuten-Strafe belegt.
Warum ist der Crosscheck gefährlich?
Somit ist der Crosscheck die unerlaubte Variante im Eishockeyspiel im Vergleich zum normalen Check, bei dem der eigene Körper eingesetzt wird. Denn durch den Stock kann es zu Verletzungen kommen und deshalb ist dies eine Situation, die man tunlichst unterlassen sollte.
Die Gefahr besteht darin, dass durch die Wucht, mit der der Stock gegen den Körper geführt wird, Verletzungen entstehen können. Eishockeyspieler haben oft 80 und mehr Kilogramm und verstärken den Druck deutlich. Daher kann es zu einer problematischen Situation kommen, die es möglichst zu vermeiden gilt. Wird der Crosscheck durchgeführt, dann wird er vom Schiedsrichter und seinen Assistenten angezeigt, die genau die Bewegung des Stockes ausführen, um die Strafe auf einfache Weise zu erklären.
Der Übeltäter hat sich dann für zwei Minuten auf der Strafbank einzufinden. In Situationen, in denen es zu einer Verletzung kommt, können es auch eine 5-Minuten-Strafe sein, das ist aber eher selten. Häufiger kann eine Verstärkung der Strafe bei hohem Stock passieren, wenn man im Gesicht getroffen wird und eine blutende Wunde davonträgt.
Crosscheck als Abwehrverhalten
Generell wird der Crosscheck selten absichtlich durchgeführt. Meist ist man in der Verteidigung einen Schritt zu spät dran und um sich zu behelfen, versucht man die Angreifer auf unerlaubte Weise zu stoppen. Gerade beim hitzigen Kampf an der Bande um den Puck kann es passieren, dass man beim Stock umgreifen wollte und dann daraus der Crosscheck entsteht, weil der Gegner schneller ist. Diese Aktion kann durchaus gefährlich werden, überwiegend gibt es aber keine Folgen, doch die Strafe gibt so und anders.
Eishockey ist zwar ein körperbetontes Spiel, aber der Schutz vor Verletzungen ist umso wichtiger, zumal bei den Männern speziell große Wucht aufeinandertrifft. Die Aktion des Crosscheck kann aber auch eine vorsätzliche und absichtliche sein, weil man noch mit einem bestimmten Herren der gegnerischen Mannschaft eine Rechnung offen hat und ihm zeigen möchte, wer hier das Sagen halt. Letztlich liegt man aber falsch, denn das Sagen hat der Schiedsrichter und man schwächt damit das eigene Team, das ein Unterzahlspiel überstehen muss.
Stockschlag im Eishockeyspiel
Gefährliches Spiel und daher 2-Minuten-Strafe
Der Stock ist im Eishockeysport natürlich das Arbeitsgerät und kann auch als Waffe eingesetzt werden, wobei man sich danach auf der Strafbank wiederfindet. Die harmlosere Variante ist der Haken, wenn man sich mit dem Stock beim Gegenspieler einhängt, um ihn auszubremsen. Das kann durchaus auch unbeabsichtigt passieren, wird aber mit einer Strafe von zwei Minuten belegt. Denn mit dem Stock kann eine Verletzung entstehen. Noch größer ist die Gefahr beim Stockschlag, bei dem man nicht den Stock linear führt, sondern eine schlagende Bewegung durchführt.
Was ist der Stockschlag im Eishockeyspiel?
Der Stockschlag ist eine Aktion im Eishockeyspiel, bei der man einen Gegenspieler mit dem Stock trifft. Es muss keine Absicht hinter der Aktion stecken, doch wenn man den Stock nutzt, um einen Schlag auszuführen, der einen Gegenspieler trifft, ist die Verletzungsgefahr groß. Das gilt für das Gesicht im Besonderen, aber auch ein Schlag auf die Beine kann das Verletzungsrisiko deutlich erhöhen. Strafen sind nicht zufällig im Regelwerk des Eishockeysports vorgesehen, sie sollen vor allem einen schützenden Charakter aufweisen und so wird der Stockschlag mit zwei Minuten belegt.
Ist die Aktion so ausgeführt worden, dass der Gegenspieler sogar verletzt wird, dann wird aus der Strafzeit von zwei Minuten rasch eine von fünf Minuten und das kann für das eigene Team sehr bitter werden, weil man nach einem Gegentreffer nicht wieder die Eisfläche betreten darf - die Strafe ist vollständig abzusitzen.
Absichtlicher Stockschlag kann teuer werden
Manchmal ist aber über dieses Strafmaß hinaus eine weitere und höhere Strafe möglich, unter anderem auch eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Dann steht man bis zum Spielende nicht mehr zur Verfügung, die eigene Mannschaft ist aber zahlenmäßig nicht unterlegen. Eine solche Strafe wird nur dann ausgesprochen, wenn das Vergehen wirklich schwerwiegender Natur ist und der Schiedsrichter keine andere Möglichkeit hat, als den Spieler vom Eis zu schicken.
Der Stockschlag ist eine jener Aktionen, die auch nicht gerne gesehen sind und schnell für Tumult sorgen können, weil das gegnerische Team dem jeweiligen Spieler rasch mitteilt, was man davon hält. Es ist aber auch häufig so, dass der Stockschlag einfach passiert, wenn man den Stock in der Höhe hält und sich der Gegenspieler unerwartet in eine andere Richtung dreht und getroffen wird. Bei raschen Wendemanövern kann das im Eishockey bald passieren.
Halten
(Gegner zurückhalten)
Halten im Eishockeyspiel
Regelwidriges Stoppen des Gegners
Fouls werden im Eishockeysport vor allem mit dem Arbeitsgerät durchgeführt - dem Stock. Der Stock wird beim Crosscheck quer gegen den Oberkörper des Gegners eingesetzt, beim Haken hängt man sich beim Gegner ein und versucht ihn so zu stoppen. Es gibt auch Fouls mit Körpereinsatz wie beim Beinstellen und es gibt noch weitere Fouls, die aber auch Auslegungssache sein können. Ein solches Beispiel ist das Halten, häufig auch als Behinderung bezeichnet.
Was ist Halten beim Eishockey?
Unter Halten versteht man im Eishockeyspiel eine Aktion, bei der man den Gegenspieler zurückhält und so verhindert, dass er seinen Angriff fortsetzen kann. Man setzt nicht den Stock ein, um sich einzuhängen, sondern hält ihn mit den Armen oder zieht ihn am Arm zurück, sodass er nicht wie geplant weiterlaufen und den Puck spielen kann oder im Falle einer Schussposition einen Torschuss anbringen kann. Gerade wenn man beim Verteidigen zu spät dran ist und der Gegenspieler zu enteilen droht, setzt man das Halten ein, um dem ein Ende zu bereiten.
Dabei wird das Halten manchmal ganz klar als 2-Minuten-Strafe geahndet, aber es gibt auch Grenzfälle. Wenn ein Spieler einen Konter einleitet und schnell Richtung gegnerisches Tor läuft und zurückgehalten wird, ist der Fall ganz klar. Wenn es aber einen Zweikampf an der Außenposition gibt und man wird zurückgehalten, ist der Fall oft auch Auslegungssage des Schiedsrichters, bis wann es ein Zweikampf ist und ab wann Halten oder Behinderung gegeben ist. Das Kriterium ist die Position der beiden Spieler. Wenn der Angreifer schon am Verteidiger vorbeigekommen war und zurückgehalten wird, ist Halten gegeben und die Strafe auszusprechen.Dabei wird das Halten manchmal ganz klar als 2-Minuten-Strafe geahndet, aber es gibt auch Grenzfälle. Wenn ein Spieler einen Konter einleitet und schnell Richtung gegnerisches Tor läuft und zurückgehalten wird, ist der Fall ganz klar. Wenn es aber einen Zweikampf an der Außenposition gibt und man wird zurückgehalten, ist der Fall oft auch Auslegungssage des Schiedsrichters, bis wann es ein Zweikampf ist und ab wann Halten oder Behinderung gegeben ist. Das Kriterium ist die Position der beiden Spieler. Wenn der Angreifer schon am Verteidiger vorbeigekommen war und zurückgehalten wird, ist Halten gegeben und die Strafe auszusprechen.
Penalty nach Halten
Es kann auch zu einem Penalty kommen, wenn ein Spieler alleine auf das Tor gestürmt wäre und zurückgehalten wird. Dann darf der Gefoulte alleine auf das Tor stürmen und nur der Torhüter kann noch einen Treffer vermeiden. Allerdings ist in dem Fall der Torhüter in der besseren Position als zum Beispiel ein Torhüter es im Fußball beim Elfmeter wäre. Denn das kleine Tor muss man erst einmal treffen, wenn sich der große Torhüter davor breit macht. Und der Torhüter muss sich nur auf den Spieler konzentrieren und nicht auf eine ganze Meute, die auf ihn zugestürmt kommt, wie das sonst im Eishockeyspiel der Fall ist.
Zeitverzögerung
(Puck absichtlich entsorgen)
Zeitverzögerung im Eishockeyspiel
Absichtlich den Puck entsorgen
Bis vor wenigen Jahren war es kein Problem für eine unterlegene Mannschaft, wenn sie im Rahmen eines Eishockeyspiels den Puck über die Bande und die Plexiglas-Abgrenzung geschossen hat. Damit wurde ein Spielzug unterbrochen und die Gefahr war fürs Erste gebannt. Heute ist eine solch absichtlich durchgeführte Aktion aber weit gefährlicher, weil sie kann als Zeitverzögerung interpretiert werden.
Was ist Zeitverzögerung im Eishockeyspiel?
Die Zeitverzögerung ist eine noch neuere Regel im Eishockeyspiel, wenn man absichtlich den Puck per hohen Schupfer in den Publikumsraum befördert. Damit ist die aktuelle Aktion beendet und ein Angriff kann so schnell unterbrochen werden. Eine solche Aktion kann passieren - bei einem Zweikampf etwa - aber wenn es offensichtlich ist, dass man absichtlich den Punkt entsorgt hat, spricht der Schiedsrichter die Entscheidung Zeitverzögerung aus.
Und diese Zeitverzögerung wird mit einer 2-Minuten-Strafe oder kleinen Bankstrafe geahndet, wobei es im Ermessen des Schiedsrichters liegt, ob die Strafe ausgesprochen oder ob die Mannschaft abgemahnt wird. Da es durchaus passieren kann, dass bei einem Zweikampf der Puck von zwei Schlägern getroffen und daher unberechenbar abgelenkt wird, landet immer wieder ein solches Gummigeschoss nicht irgendwo am Spielfeld, sondern im Publikumsraum, wobei das Publikum immer begeistert den Puck fängt. Da der Puck meist sehr abgelenkt nach außen fliegt, ist seine Geschwindigkeit geringer und die Verletzungsgefahr für die getroffenen Leute ebenfalls überschaubar.
Nun muss sich der Schiedsrichter mit seinem Team überlegen, ob eine Zeitverzögerung vorliegt. Wenn eine Mannschaft immer wieder den Puck nach draußen befördert und versucht, den Rhythmus der Angreifer zu durchbrechen, dann wird eine Strafe nicht lange auf sich warten lassen. Bei einer einmaligen Situation wird eher von der Strafe abgesehen, wobei es von der tatsächlichen Situation abhängt, wie es zum Verlassen des Pucks aus der Spielfläche gekommen ist.
Gar zu offensichtliche Aktionen sind daher keine gute Idee, weil sie für zwei Minuten das eigene Team schwächen und damit die Unterlegenheit noch stärker ausgeprägt wird. Es gibt andere Möglichkeiten, um Zeit zu gewinnen - natürlich vorausgesetzt, dass die gegnerische Mannschaft dies zulässt.
Bedeutung der Strafe
Die Regel scheint seltsam zu sein, denn man weiß ja, dass sofort die Zeit angehalten wird, wenn das Spiel unterbrochen wird. Die unterlegene Mannschaft hat also keinen Vorteil, aber das stimmt nur zum Teil. Man unterbricht nämlich den Angriffsfluss des Gegners und wenn es einfach nicht gelingt, den Puck aus dem Verteidigungsdrittel zu bringen, dann ist der Schupfer ins Publikum eine effektive Möglichkeit.
In früheren Zeiten gab es durchaus mehrere Gastgeschenke für das Publikum, aber das hat man mit der Zeitverzögerungsregel unterbunden. Heute spielt man den Puck flach in die gegnerische Hälfte oder schupft den Puck über die Spieler hinaus auf die andere Seite, weil dann die Angreifer die Zone verlassen und einen neuen Aufbau durchführen müssen.
Es macht keinen Sinn, in einer Situation, in der man schon unter Druck steht, noch zusätzliche Probleme mit dem Verlust eines Kollegen zu riskieren. Denn die Zeitverzögerung würde eine Strafe von zwei Minuten auf der Strafbank stellvertretend für das ganze Team bedeuten und dann ist man nominell auch unterlegen. Das verbessert die Situation nicht wirklich.Die Regel scheint seltsam zu sein, denn man weiß ja, dass sofort die Zeit angehalten wird, wenn das Spiel unterbrochen wird. Die unterlegene Mannschaft hat also keinen Vorteil, aber das stimmt nur zum Teil. Man unterbricht nämlich den Angriffsfluss des Gegners und wenn es einfach nicht gelingt, den Puck aus dem Verteidigungsdrittel zu bringen, dann ist der Schupfer ins Publikum eine effektive Möglichkeit.
In früheren Zeiten gab es durchaus mehrere Gastgeschenke für das Publikum, aber das hat man mit der Zeitverzögerungsregel unterbunden. Heute spielt man den Puck flach in die gegnerische Hälfte oder schupft den Puck über die Spieler hinaus auf die andere Seite, weil dann die Angreifer die Zone verlassen und einen neuen Aufbau durchführen müssen.
Es macht keinen Sinn, in einer Situation, in der man schon unter Druck steht, noch zusätzliche Probleme mit dem Verlust eines Kollegen zu riskieren. Denn die Zeitverzögerung würde eine Strafe von zwei Minuten auf der Strafbank stellvertretend für das ganze Team bedeuten und dann ist man nominell auch unterlegen. Das verbessert die Situation nicht wirklich.
Begriffe Allgemein
Eishockey allgemeine Begriffe
Allgemeine Begriffe im Eishockey wie Bully und Abseits
Ob eine Sportart beliebt ist oder nicht, erkennt man auch daran, wie viele verschiedene Begriffe es gibt. Was das Eishockey betrifft, ist die Sportart zwar offenbar auf den Winter beschränkt, aber die Popularität ist grenzenlos und dementsprechend viele Begriffe gibt es auch, die einzelne Situationen beschreiben oder umschreiben.
Allgemeine Eishockeybegriffe
Manche Begriffe kennt man natürlich sehr gut wie das Bully oder das Abseits, aber andere Begriffe sind nicht so geläufig. Um die Begriffe ein wenig besser zu untergliedern, werden auf den nachstehenden Seiten allgemeine Begriffe aufgelistet. Begriffe, die mit einer Angriffssituation in Zusammenhang stehen oder mit einer Aktion des Torhüters, in der er sich auszeichnen kann, werden in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt werden.Manche Begriffe kennt man natürlich sehr gut wie das Bully oder das Abseits, aber andere Begriffe sind nicht so geläufig. Um die Begriffe ein wenig besser zu untergliedern, werden auf den nachstehenden Seiten allgemeine Begriffe aufgelistet. Begriffe, die mit einer Angriffssituation in Zusammenhang stehen oder mit einer Aktion des Torhüters, in der er sich auszeichnen kann, werden in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt werden.
Zu den allgemeinen Begriffen zählen also Spielsituationen, die immer wieder anzutreffen sind. Das Bully ist dabei ein gutes Beispiel, denn dieses wird im Laufe eines Spieles sehr häufig durchgeführt und ist weder eine reine Verteidigungsaktion noch eine Angriffsaktion. Solche Aktionen werden im Laufe der drei Drittel und vielleicht auch noch in einer möglichen Verlängerung häufig eingesetzt, um das Spiel fortsetzen zu können.
Und dennoch gibt es eine Menge über solch allgemeine Spielsituationen im Eishockeysport zu erzählen. Und es gibt eine Menge Begriffe, die man so umschreiben könnte, die aber für jemanden, der sich mit Eishockey nicht so gut auskennt oder der sich näher mit dem Spiel auseinandersetzen möchte, unklar sein könnten.
Der Drop Pass ist so ein Fall, bei dem man nicht sofort erkennen kann, was Sache ist. Das All Star Game wird man eher einordnen können.
Begriffe Allgemein zum Eishockeyspiel
Abseits und Torraumabseits
Beschreibung: Abseits und Torraumabseits
Aufbaupass (aus der Verteidigung)
Beschreibung: Aufbaupass
Drop Pass (Überraschung!)
Beschreibung: Drop Pass
Handpass (nicht erlaubt)
Beschreibung: Handpass
Assist (Torvorlage)
Beschreibung: Assist
Bully (Wiederaufnahme des Spiels)
Beschreibung: Bully
Check (auch Bodycheck)
Beschreibung: Check oder Bodycheck
Icing (unerlaubter Weitschuss)
Beschreibung: Icing
Time-Out (Auszeit im Spiel)
Beschreibung: Time-Out
All Star Game (oft vor Saisonbeginn)
Beschreibung: All Star Game
Abseits und Torraumaabseits
Abseits im Eishockeyspiel
Abseitsregel im Angriff und in Sachen Torraum
Die Abseitsregeln kennt man von vielen Diskussionen im Fußball, doch auch in anderen Sportarten gibt es das Abseits bzw. die Abseitsregel. Im Falle von Eishockey gab es bis vor kurzem noch drei Abseitsregeln, wobei eine aber abgeschafft wurde. Der häufigste Fall ist mit dem Angriffsaufbau verbunden.
Wann gibt es im Eishockey Abseits?
Die eigentliche Abseitsregel tritt bei einem offensiven Spielzug in Kraft. Wenn eine Mannschaft in den Angriff übergeht und der Puck in das gegnerische Drittel gebracht wird, darf sich kein eigener Mitspieler bereits in diesem Drittel aufhalten. Ist dies doch der Fall, dann greift die Abseitsregel und das Spiel wird abgepfiffen und es gibt ein Bully in der neutralen Zone. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Spieler den Puck direkt geführt hat oder ob der Puck durch einen langen Pass in das gegnerische Drittel gespielt wurde - der Puck muss vor dem eigenen Spieler das gegnerische Drittel erreichen.
Allerdings gibt es zwei Ausnahmen. Im ersten Fall greift die Abseitsregel nicht, wenn die verteidigende Mannschaft den Puck selbst in das eigene Drittel zurückspielt. Nehmen wir an, dass Mannschaft B aus der neutralen Zone den Puck in das eigene Verteidigungsdrittel spielt und ein Angreifer von Mannschaft A sich dort aufhält, dann ist dies kein Abseits.
Fall zwei wird selten vorkommen, ist aber nicht restlos ausgeschlossen. Wenn ein Spieler der Mannschaft A, die angreift, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, also in verkehrter Spielhaltung, den Puck in das gegnerische Drittel bringt, gilt die Abseitsregel ebenfalls nicht.
Wann gilt Torraumabseits?
Neben diesem klassischen Abseits gibt es noch zwei weitere Regelungen. Abseitsregel Nummer zwei betrifft das Torraumabseits. Vor dem Eishockey-Tor ist ein kleiner Raum mit Linien begrenzt, der für den angreifenden Stürmer tabu ist. Betritt er diesen Raum, gibt es einen Pfiff des Schiedsrichters und das Spiel wird unterbrochen und durch ein Bully in der neutralen Zone fortgesetzt. Anders ist der Fall, wenn der gegnerische Stürmer zwar den Torraum betritt, aber nicht in das Spiel eingreift. In diesem Fall liegt passives Abseits vor und das Spiel wird nicht unterbrochen. Voraussetzung dafür ist allerdings auch, dass der Torhüter nicht irritiert wird.
Kein Zwei-Linien-Pass mehr
Die dritte Abseitsregel ist mittlerweile Geschichte. Es handelt sich dabei um die Regel des Zwei-Linien-Passes. Früher wurde das Spiel abgepfiffen, wenn ein Pass aus dem Verteidigungsdrittel über zwei Linien in das Angriffsdrittel gespielt wurde. In den europäischen Ligen hat man die Regel abgeschafft, auch in der NHL wurde ab 2005/06 von dieser Regel kein Gebrauch mehr gemacht.
Torraumabseits im Eishockeyspiel
Stürmer betritt die verbotene Zone
Der Torraum ist ein markierter Bereich vor dem Tor auf dem Eishockeyfeld. Dort darf kein Angreifer sich positionieren, wenn ein Mitspieler ein Tor zu erzielen versucht, sonst gibt es das Torraumabseits. Das Torraumabseits ist somit eine ergänzende Regel zum normalen Abseits, das sich um den Eintritt der Angreifer in die Angriffszone kümmert.
Was ist das Torraumabseits im Eishockey?
Das Torraumabseits ist im Eishockey dann gegeben, wenn ein Angreifer in den Torraum eindringt und während eines Angriffs die Aktion des Torhüters behindert. Vor dem Tor gibt es immer viel Betrieb und das Eishockeyspiel ist ein sehr schnelles, weshalb es schwierig wird, den Überblick zu behalten. Das gilt vor allem für den Torwart, der ohnehin stets im Mittelpunkt steht und schnell reagieren muss, wenn ein Schuss abgegeben wird. Wenn nun in seinem Bereich ein gegnerischer Angreifer einwirkt, werden die Möglichkeiten noch geringer, dass man erfolgreich ein Tor verhindern kann, weshalb es das Torraumabseits gibt.
Manchmal sind die Situationen so umstritten, dass der Schiedsrichter sich erst eine Bestätigung per Videobeweis holen muss, um entscheiden zu können, ob ein reguläres Tor erzielt wurde oder nicht. Ein reguläres Tor ist dann geschossen worden, wenn der Torwart nicht behindert wird und der Torraum nicht betreten wurde, bevor der Puck abgeschossen worden war. Das zu bestimmen ist mit freiem Auge oft sehr schwierig, weil die Spielzüge sehr schnell vonstattengehen.
Hat ein Gegenspieler den Torraum mit seinem Schlittschuh betreten, bevor der Schuss abgegeben wurde, dann wird das Torraumabseits ausgesprochen, das Tor gilt nicht - so der Puck hinter die Linie geschossen werden konnte und es gibt ein Bully. Die Regel schützt vor allem den Torhüter, damit nicht ständig jemand in seinem unmittelbaren Bereich Aktionen setzt, zumal mit dem Stock gefährliche Gegebenheiten ausgelöst werden könnten.
Aufbaupass
(aus der Verteidigung)
Aufbaupass im Eishockeyspiel
Gegenangriff mit Pass in die Offensive einleiten
Der Aufbaupass ist im Eishockeysport die Einleitung eines eigenen Angriffs, der meist als Gegenangriff durchgeführt wird, aber nicht zwangsläufig so gestaltet sein muss. Er wird vom Verteidiger meistens ausgelöst und gespielt, weil dieser in der Defensive den Puck besitzt und damit die Aktion einleiten kann.
Aufbaupass: von Verteidigung auf Angriff umschalten
Eine typische Situation für den Aufbaupass im Eishockeyspiel ist dann gegeben, wenn die gegnerische Mannschaft angreift, aber der Puck geht verloren und der Verteidiger spielt den Puck schnell in die neutrale Zone zum Stürmer, damit dieser selbst sein Glück versuchen kann. In diesem Fall wurde ein Aufbaupass gespielt, der doppelt gefährlich ist. Einerseits ist die gegnerische Mannschaft in der Vorwärtsbewegung, mit dem Ziel, ein Tor zu schießen und damit entblößt sie ein wenig ihre Abwehr und andererseits kann der Aufbaupass eine überraschende Aktion sein, mit der nicht zu rechnen war und die einen gefährlichen Konter darstellen kann.
Aber auch aus einer ruhigen Situation heraus wird dieser Pass gespielt, um den Gegner zu überraschen. Der Verteidiger führt den Puck aus dem Verteidigungsdrittel heraus und spielt einen überraschenden langen Pass zum Stürmer, damit dieser samt Puck in das Angriffsdrittel laufen kann, um seinen Schuss anzubringen. Häufig spielen die Verteidiger den Puck hin und her, weil sie keine Angriffsmöglichkeit sehen, aber auch, um die Gegner ein wenig in Sicherheit zu wiegen.
Wenn sich dann eine Lücke zeigt, wird der schnelle Pass nach vorne gespielt, um mit dem Überraschungsmoment zu einer guten Chance zu kommen. Das bedeutet auch, dass der Verteidiger einen Überblick über das Spiel haben muss und er muss auch aufpassen, dass ein Pass nicht noch im eigenen Drittel abgefangen wird, weil das könnte zu einem gefährlichen Konter führen und statt einer eigenen Chance kassiert man vielleicht sogar ein billiges Tor.
Drop Pass
(Überraschung)
Drop Pass oder Dropping im Eishockeyspiel
Überraschende Weitergabe des Puck
Der Drop Pass oder auch das Dropping ist eine Spielvariante, die darauf fußt, dass man den Gegner überrascht. Ein Spieler führt eine Angriffsaktion durch und die Verteidigung konzentriert sich auf diesen Spieler. Er führt den Puck in die Angriffszone und die Abwehr möchte ihn aufhalten, aber er reagiert mit dem Drop Pass.
Was ist der Drop Pass?
Ein Angreifer erhält im Eishockeyspiel den Puck und stürmt auf das Tor zu. Plötzlich spielt er den Drop Pass also läuft er ohne Puck weiter, weil er ihn liegen gelassen hat, damit der Mitspieler die Aktion fortsetzt. In der Konzentration sind die Abwehrspieler noch mit diesem letzten Spieler beschäftigt und folgen ihm auf seinem Weg, obwohl schon ein anderer den Puck führt. Hat sich ersterer Spieler in die Flügelposition begeben, dann kann sich schnell in der Mitte eine Lücke bilden, die für einen Torschuss geradezu eine Einladung darstellt. Damit ist die Abwehr überrascht worden und mit einfachsten Mitteln wurde eine große Torchance erarbeitet.
Der Drop Pass (to drop = fallen lassen) ist damit eine nicht so offensichtliche Aktion, um einen Angriff einzuleiten oder abzuschließen. Der Drop Pass muss nicht unbedingt im Angriffsdrittel erfolgen, er wird auch häufig in der eigenen Verteidigung eingesetzt. Sehr häufig findet man diese Technik beim Aufbau der nächsten Aktion, wenn sich ein Spieler hinter das eigene Tor zurückzieht, um abzuwarten, dass die Mitspieler gewechselt haben. Dann lässt er den Puck einfach liegen und sein Mitspieler kommt mit Schwung und holt sich den Puck ab, um mit Tempo den nächsten Angriff zu versuchen. In dem Fall ist kein Überraschungsmoment gegeben, aber der Puck wurde trotzdem übergeben, ohne dass ein Pass im eigentlichen Sinne erfolgt war.
Das große Überraschungsmoment gibt es bei den Angriffssituationen, weil sich die Abwehr auf einen Spieler konzentriert und dieser lässt die Verteidiger ins Leere laufen. Das funktioniert aber nicht immer, erfordert ein blindes Verständnis und man darf es nicht zu oft probieren, weil dies die Gegner schnell merken und dann rascher reagieren können. Denn fatal wäre, wenn der Gegenspieler das rechtzeitig erkennt und selbst den Puck erbt, um einen schnellen Gegenangriff als Konter einzuleiten.
Handpass
(nicht erlaubt)
Handpass im Eishockeyspiel
Unerlaubter Pass zum Mitspieler
Der Puck wird im Eishockeysport mit dem Schläger bewegt, wobei es auch sehr scharfe und schnelle Schüsse gibt, aber man kann auch verschiedene andere Formen des Passes wie den Drop Pass wählen, bei dem zum Beispiel der Puck für den nächsten Spieler liegen gelassen wird. Eine Variante, die nicht erlaubt ist, aber auch einen Begriff erhalten hat, ist dabei der Handpass.
Wann wird ein Handpass gepfiffen?
Für manche ist vielleicht nicht bekannt, dass es durchaus erlaubt ist, die Scheibe mit der Hand zu fangen. Die Auflage der Regeln besagt aber, dass man danach den Puck sofort wieder auf die Eisfläche fallen lässt, um damit weiterzuspielen. Das ist eine regelkonforme Lösung, wenn zum Beispiel ein zu weiter Pass hochgeflogen kommt und man den Puck auf die Eisfläche zurückbringt. Nicht erlaubt ist aber der Handpass, bei dem man den Puck auch abfängt, aber dann zu einem Mitspieler wirft. Man kann den Puck auf der Eisfläche zuwerfen, aber nicht wie zum Beispiel im Handballsport den Puck weiter werfen, damit der Kollege zum Torschuss ansetzen kann.
Wird dies doch getan, dann pfeift das Schiedsrichterteam ab und die Aktion wird unterbrochen. Als Folge gibt es ein Bully an nächster Stelle, je nachdem, wo sich der Handpass ereignet hatte und dann geht es von vorne los. Es gibt keine Strafe, wenn man einen solchen Pass durchführt, aber man führt eine irreguläre Aktion durch, weshalb die Unterbrechung verpflichtend in den Regeln vorgeschrieben ist. Der Grenzfall ist, wenn man die Hand hochhält, um den heranfliegenden Puck abzufangen, aber ihn nicht fangen kann. Dann kann es passieren, dass der Puck doch zum Mitspieler fällt, aber meist wird auch dann ein Handpass gegeben.
Die Aktion mit dem Handpass ist aber eine seltener anzutreffende Handlung, weil auch beim langen Pass der Puck sich meistens auf der Eisfläche bewegt und nicht nach oben fliegt. Es kommt ab und an vor, spielt für den Ausgang des Matches aber keine Rolle und sorgt auch für keine Bestrafung, ergo auch für keine spielentscheidende Szene, die große Diskussionen nach sich ziehen würde.
Was man häufig sieht ist die Aktion des Torhüters, der einen gegnerischen Schuss mit der Fanghand hält und den Puck sofort aufs Eis fallen lässt, um mit dem Schläger zum mitspielenden Verteidiger zu spielen. Damit verhindert er, dass vor seinem Tor ein Bully ausgeführt werden kann. Auch hier gilt, dass der Torhüter den Puck fast senkrecht auf die Eisfläche fallen lässt. Er darf nicht den Puck weiter werfen, weil das wäre dann auch ein Handpass.
Assist
(Torvorlage)
Assist oder Torvorlage im Eishockeyspiel
Vorlage für ein tatsächlich erzieltes Tor
Im Zusammenhang mit der häufig bemühten Statistik im Eishockeysport werden besonders gerne und oft die Tore und Assists genannt. Diese beiden Werte zeigen an, wie effizient ein Spieler für eine Mannschaft ist. Die Tore sind klar - man hat dem Gegner den Puck ins Netz setzen können, die Assists sind dabei die Torvorlagen. Auch bei anderen Mannschaftssportarten hat man die Assists zu zählen begonnen, teilweise war der Eishockeysport dabei das Vorbild.
Was ist ein Assist im Eishockey?
Der Assist ist die erfolgreiche Torvorlage im Eishockeyspiel, wobei es auch zwei Assist-Geber geben kann. Im Eishockey gibt es dabei viele Möglichkeiten, denn ein Assist kann auch von mehr als einem Spieler geleistet werden. Die klassische Möglichkeit besteht darin, dass der Flügelstürmer vom Verteidiger den Puck zugespielt bekommt und in das Angriffsdrittel läuft. Er überwindet den Verteidiger und spielt von der Außenposition in die Mitte, wo der Mittelstürmer (Center) zum Tor einnetzt. Der Mittelstürmer bekommt das Tor zugeschrieben, der Flügelstürmer den Assist.
Eine andere Situation ist dann gegeben, wenn der Verteidiger von der blauen Linie zum Flügelstürmer spielt und dieser übernimmt den Puck direkt für einen Pass in die Mitte, den der Mittelstürmer wieder einnetzt. Der Mittelstürmer bekommt sein Tor, Verteidiger und Flügelstürmer erhalten jeweils einen Punkt in der Scorerwertung für den Assist. Denn die Aktion ist eigentlich vom Verteidiger ausgegangen. Der Flügelstürmer hat den Schwung seines Schusses nur verlängert und damit die Verteidigung überrascht.
Daher kann es sein, dass mehr als ein Spieler für den Assist infrage kommt und so wie es zwei Assistgeber gibt, gibt es auch keinen. Das ist dann der Fall, wenn ein Spieler von der neutralen Zone oder gar aus dem eigenen Verteidigungsdrittel aus einem Angriff durchführt und bis zum Torhüter gelangt, um diesen zu überwinden und ein Tor zu erzielen. In dem Fall gibt es natürlich den Torpunkt für den Spieler, aber keinen Assist, weil es ja auch keine Hilfestellung von Mitspielern gab.
Bully
(Wiederaufnahme des Spiels)
Bully oder Face-Off im Eishockey
Das Anspielen im Eishockey für die Fortsetzung des Spiels
Das Bully, auch Face-Off bezeichnet, ist eine Spielsituation im Eishockey, wenn nach einer Unterbrechung das Spiel wieder aufgenommen wird. Im Fußball würde man vom Schiedsrichterball sprechen, im Eishockey ist diese Spielsituation üblich. Einer der Linesman wirft den Puck auf die Eisfläche und von jeder Mannschaft wird ein Spieler ausgewählt, der versucht, den Puck unter Kontrolle zu bringen.
Wie wird das Bully durchgeführt?
Das Bully braucht drei Personen: den Linesman mit dem Puck und von jeder Mannschaft einen Mitspieler. Die Mitspieler waren mit ihrem Schläger auf der Eisfläche auf den Puck, den der Linesman zu Boden wirft. Meist wird versucht, den Puck hinter sich zum Mitspieler zu spielen, damit dieser den nächsten Angriffszug durchführen kann, denn da man direkt gegenüber des gegnerischen Mitspielers in Stellung geht, um beim Bully erfolgreich zu sein, ist der Weg nach vorne versperrt. Der Gegner wird kaum zur Seite springen und Platz machen.
Welche Bedeutung hat das Bully?
Das Bully und die Erfolgsquote beim Bully ist nicht unbedingt spielentscheidend, aber eine hohe Quote an Durchsetzungsvermögen kann helfen, mehr Spielanteile zu bekommen und das Spiel einfacher zu gestalten, da man selbst den Puck führen und steuern kann, statt dem Gegner nachzulaufen, um ihm das Spielgerät abzunehmen. Spieler mit einer hohen Quote an erfolgreichen Bullys sind daher erstens sehr beliebt und zweitens dann auch oft beim Bully gefragt.
Wie bei vielen anderen Spielsituationen auch gibt es beim Bully Experten, die bekannt dafür sind, dass sie besonders gute Reflexe haben, denn diese braucht man, um sich in der "Mann gegen Mann"-Situation als Sieger zu erweisen. Auch die Linesman müssen gute Reflexe haben, denn die Bewegung, um den Puck direkt in der Mitte über den Schlägern der beiden Spieler aufs Eis zu bringen, muss kurz sein und der Arm muss schnell in die Höhe gelangen, weil mit den Schlägern geht es sofort zur Sache.
Bully und Anspielkreise
Ausgeführt wird das Bully an den dafür vorgesehenen Punkten auf der Eisfläche. Es gibt links und rechts im Angriffs- und Verteidigungsdrittel zwei Bullypunkte als Zentrum der Anspielkreise, sowie in der neutralen Mittelzone. Zusätzlich gibt es den Mittelpunkt, bei dem das Bully ausgeführt wird, wenn ein Tor gefallen war oder wenn ein Drittel begonnen wird.
Das Bully wird je nach Spielsituation ausgeführt. Wenn ein Torwart den Puck fängt und nicht sofort wieder freigibt, wird abgepfiffen und es gibt ein Bully im Angriffsdrittel des Gegners, also in der Verteidigungszone des eben aktiven Torwarts. Bei einem unerlaubten Weitschuss gibt es auch in der Verteidigungszone das Bully. Nach einem Tor wird bei der Mittelauflage das Bully durchgeführt und bei einem Foul dort, wo das Vergehen stattgefunden hat.
Check oder Bodycheck
(auch Bodycheck)
Check oder Bodycheck im Eishockeyspiel
Erlaubter Körperkontakt mit dem Gegenspieler
Eishockey ist nicht nur eine der schnellsten Mannschaftssportarten, sie ist auch eine der intensivsten, was den Körpereinsatz betrifft. Dieser Faktor unterscheidet massiv das Eishockey der Männer von jenem der Frauen, denn in zweiterem Fall ist der Bodycheck und andere Mittel, um den Körper einzusetzen, verboten, während in ersterem Fall der Körpereinsatz geradezu Pflicht ist.
Was ist der Bodycheck?
Mit dem Begriff des Bodycheck ist der Körpereinsatz im Eishockey gemeint, bei dem ein Spieler seinen Gegner durch Einsatz seines ganzen Körpergewichts von seiner geplanten Bahn abbringen möchte und dies gelingt auch recht häufig. Der Bodycheck ist im Eishockey kein Foul und wird auch nicht bestraft, solange der Körpereinsatz im Rahmen der Regeln bleiben. Somit ist dies eine Form des Körpereinsatzes, der regelkonform umgesetzt wird und dadurch unterscheidet sich das Eishockey von Fußball oder Handball nachhaltig. Das ist aber auch nur möglich, weil die Eishockeyspieler entsprechend ausgestattet und gepolstert sind.
In vielen Fällen wäre der Bodycheck gar nicht nötig, weil man den Puck sowieso in der eigenen Mannschaft führt, aber man kann sich damit auch Respekt verschaffen und es geht auch um Psychologie bzw. gilt es festzustellen, wie sehr sich der Gegner einschüchtern lässt. Ist die Mannschaft spielerisch unterlegen, wird mit Bodycheck und aggressivem Körpereinsatz versucht, das Manko durch Kampfeinsatz zu kompensieren und die spielerisch stärkere Mannschaft aus dem Konzept zu bringen.
Grenzen des Bodycheck
Das gelingt aber auch nicht immer und die Grenze zwischen erlaubten und unerlaubten Mitteln ist sehr schnell erreicht. Solange man nur den Körper einsetzt, ist kein Problem gegeben, aber wenn man zu härteren Mittel greift, beispielsweise den Stock zur Hilfe nimmt, handelt man sich eine Strafe ein und dann gibt es ein Power-Play für die gegnerische Mannschaft.
Obwohl die Eishockeyspieler sehr gut geschützt sind, kann es beim Bodycheck zu Verletzungen kommen, weshalb der Eishockey-Weltverband (IIHF) den Strafkatalog erweitert hat. Das betrifft auch den Bodycheck, und zwar dann, wenn man den Körpereinsatz gegen den Körper des Gegners dann durchführt, wenn der gegnerische Spieler dies nicht sehen kann, also ein Check von hinten, um ihn gegen die Bande zu drücken. Da der Gegner die Aktion nicht sehen kann, erwartet er sie auch nicht und kann nicht gegensteuern, wodurch es schon zu Verletzungen kam.
Der normale Check von Mann gegen Mann im Rahmen des Spiels ist natürlich weiterhin zugelassen und ist auch irgendwo ein Herzstück des Eishockeys. Es ist ohnehin seltsam, dass bei Eishockeyspielen und vollem Haus mit tausenden Zuschauern keine Ausschreitungen passieren, während beim Fußballspiel Krawalle häufig berichtet werden müssen. Eine Theorie ist, dass durch die Kämpfe am Eis die Lust an eigene Kämpfe verloren geht. Ob das so richtig ist, sei dahingestellt.
Icing
(uneerlaubter Weitschuss)
Icing oder unerlaubter Weitschuss im Eishockeyspiel
Unerlaubte Befreiung der Verteidiger
Es gibt Spielsituationen im Eishockey, in denen eine Strafe ausgesprochen wird, zum Beispiel beim Crosscheck und andere, bei denen das Spiel auch unterbrochen wird, aber keine Strafe erfolgt. Zur zweiten Gruppe zählt auch das Icing bzw. der unerlaubte Weitschuss - eine Situation, die es häufig im Eishockeymatch gibt.
Was ist das Icing im Eishockey?
Im Eishockeysport darf man einen weiten Pass schlagen, wobei nicht mehr als zwei Linien überquert werden dürfen. Hat ein Mitspieler in der Zwischenzeit den Puck berührt, darf auch weitergespielt werden. Man spricht auch vom Zweilinienpass, wenn von der Verteidigung zur blauen Linie des Angriffsdrittels gespielt wird. Doch wenn kein Mitspieler den Puck berührt und man diesen von der Verteidigungszone in die Angriffszone spielt, liegt Icing vor, zu Deutsch ein unerlaubter Weitschuss.
Die Folge ist, dass das Spiel abgepfiffen und damit unterbrochen wird und es gibt ein Bully im Verteidigungsdrittel der Mannschaft, die diesen Fehler verursacht hatte. Das Ziel ist dabei vor allem Entlastung, wenn der Gegner intensive Angriffsbemühungen zeigt und man den Puck einfach loswerden will. Auch wenn das Bully wieder in der Verteidigungszone erfolgt, hat man den Spielfluss durch die Aktion doch unterbrochen und sich eine kurze Atempause verschafft.
Zudem muss nicht jeder weit über die Eisfläche gespielte Schuss ein unerlaubter Weitschuss sein. Icing liegt nämlich zum Beispiel dann nicht vor, wenn ein Spieler - egal von welcher Mannschaft - den Puck berührt, bevor er das Angriffsdrittel erreichen konnte. In diesem Fall ist die Atempause sogar noch länger, weil die angreifende Mannschaft erst zurückeilen muss, um den Puck zu holen und außerdem müssen alle Angreifer die Angriffszone verlassen.
Kein Icing bei Unterzahl
Eine Sonderregelung gibt es für die Mannschaft in Unterzahl. Wenn man gerade dem Power Play ausgesetzt ist, dann gibt es den unerlaubten Weitschuss nicht. Die Aktion gilt dann als in der Not gespielte Verteidigung und wird nicht mit einem Bully vor dem Tor bestraft, sondern das Spiel geht normal weiter. Daher ist beim Penaltykilling die Aufgabe der Verteidigung auch, den Puck zu erobern und aus dem Verteidigungsdrittel zu befördern.
Time-Out
(Auszeit im Spiel)
Time-Out im Eishockeyspiel
Auszeit für taktische Besprechungen
Das Time-Out ist eine Möglichkeit im Mannschaftssport, um sich zu besprechen, ohne etwas im Spielverlauf zu verpassen. Es gibt diese Möglichkeit im Handball und anderen Sportarten und auch im Eishockeyspiel. Im Eishockey ist die Auszeit so geregelt, dass man sie einmal pro Spiel einfordern kann, aber nicht muss.
Time-Out im Eishockey
Während eines Eishockeyspiels gibt es daher nur das Time-Out eine Möglichkeit, um für Ruhe zu sorgen - sieht man von den Drittelpausen ab. Die Spieler wenden sich der Betreuerzone zu und besprechen sich wegen taktischer Möglichkeiten oder einfach nur, um den Gegner aus der Fassung zu bringen, bei dem es gerade sehr gut gelaufen war. Es gibt daher verschiedene Szenarien, wann ein Time-Out einberufen wird, wobei es exakt 30 Sekunden dauert.
Eine Möglichkeit, die seltener gewählt wird, ist ein Time-Out in einer frühen Phase des Spiels, weil der Gegner einen Lauf hat und einen Angriff nach dem anderen fährt. Liegt man 0:3 zurück und sieht sich einem Debakel gegenüber, kann der Trainer ein Time-Out einberufen, um seinen Spielern ein wenig Luft zu verschaffen. Taktisch kann man wenig besprechen, es sei denn, es könnte mit Umstellungen eine Besserung erzielt werden. Diese Form des Time-Out kommt vor, ist aber eher selten
Time-Out meist knapp vor Schluss des Spiels
Typischer ist das Time-Out am Ende des Spiels. Vor allem eine Mannschaft, die einen Rückstand aufholen muss, bespricht sich mit dem Trainer, bevor der Torhüter herausgenommen wird. Bei 2:5 macht das keinen Sinn, steht es aber 4:5 und man könnte mit einem Feldspieler mehr noch einmal für Druck sorgen und den Ausgleich doch noch schaffen, dann ist die Besprechung taktisch sogar sehr wichtig. Vor allem in den letzten Minuten ist diese Auszeit daher ein typisches Werkzeug der Trainer, um die letzten Ideen hervorzukramen und den Spielern vorzustellen.
Steht es hingegen ohnehin 5:1, dann braucht man das Time-Out nicht, weil das Spiel gelaufen ist. Die Maßnahme soll der Mannschaft helfen, in einem hektischen Spiel kurz Ruhe zu finden, sich zu sammeln und mit voller Konzentration die letzten Minuten zu spielen, um doch noch den Erfolg einzufahren. Allerdings bespricht sich zeitgleich natürlich auch die andere Mannschaft und sammelt sich ebenso. Deren Trainer wird versuchen zu erahnen, was sein Kollege sich überlegt hat und seine Mannschaft darauf einstellen.
All Star Game
(oft vor Saisonbegginn)
Eishockey All Star Game
Bekannte Spieler im Show-Spiel
Im modernen Eishockeysport gibt es natürlich auch die Show, vor allem aber den beinharten Kampf um Tore, Siege und Punkte, sei es in der Meisterschaft oder beim Kampf in der Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften. Nur manchmal gibt es eine entspanntere Variante und dazu zählt auch das All Star Game, wie es in der NHL immer wieder angeboten wird.
Was ist das All Star Game?
Das All Star Game ist ein Showspiel, bei dem zwei Mannschaften antreten, die in der Zusammensetzung normalerweise nicht anzutreffen sind. Denn je nach Vorgabe werden die Spieler durch die Fans gewählt oder der Veranstalter oder Medien haben die Auswahl getroffen, wer nun zu den Superstars gehört, die dabei mitwirken dürfen. Somit ist es fast wie ein "Best of" der aktuellen Eishockeyszene und damit sind die Eintrittskarten auch sehr begehrt.
Häufig werden solche Spiele auch mit einem guten Zweck verbunden und natürlich ist das All Star Game auch ein guter Werbeträger für den Sport. Die Spieler selbst finden es meistens witzig, an so einem Spiel teilzunehmen, wobei es eine Ehre ist, ausgewählt zu werden. Gerade für junge Spieler, die das erste Mal teilnehmen dürfen, ist es etwas Besonders. Der Ehrgeiz ist natürlich auch dann nicht abgeschaltet und die Spieler wollen sich gut präsentieren.
Daher ist die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auch im All Star Game nicht ausgeschlossen, aber generell ist es ein Spiel, bei dem vor allem die Zusammenstellung der Mannschaften als Star gilt. Jeder Trainer, jeder Vereinspräsident hätte gerne die Teams unter Vertrag, die beim All Star Game auf das Eis laufen und ihre Kunst als Showeinlage präsentieren. Auch medial wird dieses Spiel nicht nur live übertragen, sondern es wird weltweit darüber berichtet. Der Werbewert ist sehr groß und der Spaß kommt bei Spieler und Publikum natürlich auch nicht zu kurz.
Begriffe Torwart
Eishockeybegriffe zum Thema Torwart
Torwart, seine Ausstattung und Aktionen
Der Eishockeysport hat sehr viel zu bieten - unter anderem auch eine ganze Menge an unterschiedlichen Begriffen. Um diese zu untergliedern, gibt es verschiedene Gruppen, die geschaffen werden können. Diese Gruppe bezieht sich nun auf die Eishockeybegriffe, die mit dem Torwart oder auch Torhüter in Zusammenhang zu sehen sind.
Eishockeybegriffe rund um den Torwart
Dazu gehören Bezeichnungen, was die Ausstattung betrifft, ebenso wie auch Bezeichnungen, die die Abwehraktionen umschreiben. Und davon gibt es eine ganze Menge, wobei die Begriffe hilfreich sein können, wenn man über die Leistungen eines Torwarts in einem bestimmten Spiel sprechen möchte. Denn mit dem Signalwort weiß der Gesprächspartner als Insider des Eishockeysports sofort, was gemeint ist und welche Aktion gerade zur Sprache kommt.
Der Torhüter ist ein besonderer Spieler im Eishockeysport. Er beteiligt sich eigentlich nicht an den Aktionen, steht aber stets im Mittelpunkt und kann sich nicht für ein paar Augenblicke gedanklich zurückziehen, wie dies beim Fußballsport schon eher möglich ist. Weil selbst beim Angriff der eigenen Mannschaft kann der Puck in Sekundenschnelle wieder auf dem Retourweg sein und der Gegner greift mit einem Konter an. Wenn man dann nicht mit der Konzentration vorhanden ist, gibt es das nächste Gegentor.
Dabei sind die Begriffe aber nicht nur mit den Aktionen, sondern auch mit den Bewertungen verknüpft. Ein Shutout zum Beispiel ist ein Spiel, in dem der Torwart nicht ausgetauscht wurde und kein einziges Gegentor einstecken musste. Es ist dies also ein Begriff, den man auch als Lob interpretieren kann und der in der Statistik Eingang findet. Mehr noch - gerade dieser Begriff ist auch für die ganze Mannschaft ein Thema, weil man gerne berichten möchte, dass man kein Gegentor kassiert hat. Der Torwart steht zwar im Mittelpunkt, man zeichnet sich aber auch mit der ganzen Verteidigung aus.
Typische Begriffe zum Torwart sind:
- Big Save
- Butterfly-Stil
- Einfrieren
- Rebound
- Shutout
Manche Begriffe beziehen sich auf das Tor selbst:
- kurze Ecke: näher vom Schützen aus gesehen
- lange Ecke: weiter vom Schützen aus gesehen
- Pfosten: die Torstangen
- Pipe: englisch für Pfosten
- Querlatte
- Slot: der Raum vor dem Tor für möglichen Torschuss
Begriffe zum Torhüter im Eishockeyspiel
Big Save (Heldentat des Torhüters)
Beschreibung: Big Save
Einfrieren (Puck wird festgehalten)
Beschreibung: Einfrieren
Butterfly-Stil (Torhüter macht sich breit)
Beschreibung: Butterfly-Stil
Rebound (zweite Torchance)
Beschreibung: Rebound
Shutout (kein Tor zugelassen)
Beschreibung: Shutout
Big Save
(Heldentat des Torhüters)
Big Save des Eishockeytorhüters
Große Heldentat des Torwarts
Die Aufgabe des Torwarts im Eishockeysport besteht darin, möglichst wenige Tore zuzulassen, damit das eigene Team gewinnen kann. Dabei gibt es zahlreiche Aktionen im Laufe eines Spieles, bei denen sich ein Torwart auszeichnen kann. Es gibt aber auch Situationen, in denen es nicht so selbstverständlich ist, dass eine Abwehr gelingen kann.
Was ist ein Big Save im Eishockey?
Gelingt dem Torhüter im Eishockeyspiel eine besondere Abwehrleistung, dann spricht man von einem Big Save. Übersetzen kann man den Ausdruck als tolle Abwehrreaktion und gemeint sind damit Situationen, in denen der Torwart zwar gefordert ist, aber nicht unbedingt auf der Siegerseite stehen muss. Eine solche Situation ist gegeben, wenn von der blauen Linie ein scharfer und präziser Schuss in Richtung Kreuzeck abgegeben wird und der Torwart diesen Schuss trotzdem fangen kann. Eine solche Tat wird dann gerne als Big Save umschrieben.
Torhüter, die für solche Aktionen bekannt sind, haben einen hohen Wert für die Mannschaft, denn das Team weiß, dass man sich auf den Torhüter verlassen kann. Es ist im Eishockey nicht einfach, die Schüsse abzuwehren. Der Puck ist klein und fliegt mit oft über 100 km/h daher und man hat wenig Zeit für die Reaktion. Außerdem verläuft das Spiel sehr schnell, sodass man kaum Zeit zur Reaktion hat, wenn man gerade einen Schuss abwehren konnte. Hat ein zweiter Spieler die Möglichkeit, den Puck im Tor unterzubringen, braucht es schon eine besondere Tat und eine schnelle Reaktion.
Das erscheint unwahrscheinlich, weil die Torhüter dick eingepackt sind, um von den Treffern der Pucks geschützt zu bleiben. Aber sie sind beweglicher, als man annehmen sollte und sehr gute Torhüter spielen sogar aktiv im Match mit und rücken auch schon ein wenig aus dem Torraum heraus, um einen Puck gleich weiterzuspielen. Beim Big Save kann die Bewegungsfähigkeit unter Beweis gestellt werden, um ein fast sicheres Tor doch noch zu unterbinden.
Aktionen beim Big Save
Was ein Big Save ist, ist nirgends niedergeschrieben. Wenn aber ein Stürmer alleine auf den Torhüter zuläuft und der Torhüter kann das erwartbare Tor verhindern, dann ist das eine Heldentat und damit ein Big Save. Gleiches gilt bei einem sehr scharfen und präzisen Schuss, den man trotzdem abwehren konnte und noch mehr bei einem Konter, bei dem zwei oder gar drei Spieler auf den Torhüter zulaufen. Seine Chancen sind dann gering, doch wenn er ein Tor vermeiden kann, ist er zu Recht ein Held.
Einfrieren
(Puck wird festgehalten)
Einfrieren im Eishockeyspiel
Torwart hält den Puck fest
Der Eishockeysport wird auf einer Eisfläche durchgeführt, aber mit dem Einfrieren ist nicht die Temperatur gemeint oder dass einem Spieler kalt ist, sondern der Begriff bezieht sich auf ein Abwehrverhalten des Torwarts, das häufig anzutreffen und zu beobachten ist. Es wird vor allem dann durchgeführt, wenn es zu einer gefährlichen Situation kommen könnte.
Was ist das Einfrieren im Eishockey?
Mit dem Begriff Einfrieren, im englischen Sprachgebrauch auch Freeze the puck genannt, bezeichnet man im Eishockeysport die Reaktion des Torwarts, wenn er mit seinem Handschuh den Puck festhält. Er ist damit für das Spiel gesperrt und es darf niemand mit einem Stock versuchen, ihm den Puck wegzunehmen, wobei das ohnehin nicht ratsam wäre. Wenn der Torwart den Puck bereits fixiert hat und ein Gegenspieler stochert noch nach, gibt es nämlich üblicherweise richtig Ärger und der Gegenspieler wird auf sehr undiplomatische Weise auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Im extremsten Fall beginnt eine richtige Schlägerei, denn der Torwart wird beschützt, und zwar konsequent. Er könnte auch wirklich verletzt werden, wenn mit dem Stock nachgestochert wird.
Eine Situation, in der der Torwart den Puck einfriert, ist dann gegeben, wenn es knapp vor dem Tor zu hektischen Manövern kommt. Bevor ein Gegenspieler in eine Schussposition kommen kann, wirft sich der Torwart nach vorne und fixiert den Puck. Damit ist der Spielzug unterbrochen und der Schiedsrichter pfeift ab. Als Nächstes wird im Verteidigungsdrittel ein Bully durchgeführt, um das Spiel fortzusetzen.
Bei einer starken Mannschaft neigt der Torhüter dazu, den Puck nicht einzufrieren, sondern mit dem Stock an seinen Mitspieler weiter zupassen, damit man nicht Gefahr läuft, ein Bully vor dem eigenen Tor zu haben. Außerdem kann man so das Spiel beschleunigen und einen Gegenangriff einleiten. Ist die Situation aber gefährlich oder wird sie zumindest so eingestuft, dann greift der Torwart schon eher zu. Das gilt auch für einen Rückpass, bei dem ein Gegenspieler nachsetzt und daher Gefahr droht.
Butterfly-Stil
(Torhüter macht sich breit)
Butterfly-Stil des Eishockey-Torhüters
Breitmachen vor dem Tor
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man als Torhüter den Torerfolg des gegnerischen Angreifers verhindern kann, wobei sich manche Bewegungsabläufe standardisiert haben. Der Standard schlechthin im Bewegungsablauf ist der Butterfly-Stil, bei dem es vor allem darum geht, sich vor dem Tor besonders groß und breitzumachen.
Was ist der Butterfly-Stil?
- Der Butterfly-Stil heißt so, weil man vom Schmetterling (= Butterfly) die großen Flügelflächen zu beiden Seiten kennt. Der Torhüter im Eishockeyspiel streckt in ähnlicher Weise Arme und Beine auseinander, sodass er sich samt seiner Schutzausrüstung breiter machen kann als er in Wirklichkeit ist. Damit reduziert er die Chance, dass der Angreifer eine Lücke findet, um ein Tor zu schießen.
Es fällt auf, dass das Tor im Eishockeyspiel viel kleiner ist als etwa im Handballspiel oder im Fußballsport. Aber dafür ist das Spielgerät mit dem Puck auch wesentlich kleiner als jede Form von Ball und fliegt auch viel schneller. Es braucht daher auch einen großen Torhüter, um die Chance einzudämmen, dass der Gegner ein Tor erzielen kann und diese Chance wird mit dem Butterfly-Stil noch verstärkt. Der Torhüter sieht den Angreifer auf sich zueilen und macht sich breit, indem er die Beine samt ihrer Beinschoner vom Körper spreizt, wodurch er noch breiter wirkt, als er es ohnehin schon ist.
Die Folge ist, dass der Angreifer viel weniger Fläche vom Tor erkennen kann, um einen Treffer zu erzielen. Wenn er durch einen Verteidiger zusätzlich unter Druck gesetzt wird, hat er kaum Zeit zu reagieren und muss auf die Geschwindigkeit vertrauen, die der Puck durch den Schuss erhalten wird. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass der Torerfolg gelingt, aber der Butterfly-Stil bringt vor allem einen Vorteil: Man deckt den unteren Bereich des Tores gut ab, das heißt, dass ein Torerfolg durch einen flachen Schuss sehr schwer möglich ist.
Das ist auch der Grund, warum man im Eishockeyspiel oft beobachten kann, dass die Angreifer den Puck nach oben schießen, um den Torhüter zu überraschen. Er braucht dann sehr schnelle Reflexe, um den Puck doch abwehren zu können und wenn er nicht damit rechnet, sind die Einschussmöglichkeiten besser als am Boden der Eisfläche selbst.
Butterfly-Stil als typische Reaktion
Wenn man im Spiel nur auf den Torhüter achtet, wird man feststellen, dass er für den Fall eines Schusses auf jeden Fall den Butterfly-Stil zumindest andeutet. Sollte doch ein Schuss erfolgen, kann er entsprechend reagieren, aber bei hohen Schüssen muss er mit den Armen ebenfalls schnell parat sein. Da Eishockey ein sehr schneller Sport ist und der Puck oft auch abgefälscht wird, weiß man selten, wohin die Scheibe fliegen wird. Mit dem genannten Abwehrverhalten hat man ein gutes Rüstzeug, aber noch keine Garantie, dass man wirklich erfolgreich sein kann.Wenn man im Spiel nur auf den Torhüter achtet, wird man feststellen, dass er für den Fall eines Schusses auf jeden Fall den Butterfly-Stil zumindest andeutet. Sollte doch ein Schuss erfolgen, kann er entsprechend reagieren, aber bei hohen Schüssen muss er mit den Armen ebenfalls schnell parat sein. Da Eishockey ein sehr schneller Sport ist und der Puck oft auch abgefälscht wird, weiß man selten, wohin die Scheibe fliegen wird. Mit dem genannten Abwehrverhalten hat man ein gutes Rüstzeug, aber noch keine Garantie, dass man wirklich erfolgreich sein kann.
Rebound
(zweite Torchaance)
Rebound im Eishockeyspiel
Gefährliche Abwehraktion des Torwarts
Das Eishockeyspiel ist die schnellste Form des Mannschaftssports und es heißt hier vor allem für die Torhüter, sehr schnell zu reagieren und das auch im zweifachen Sinne. Zum einen muss der Puck abgewehrt werden, zum anderen aber so, dass er nicht doch noch im Tor landet. Man sollte also keine Chance auf einen Rebound geben.
Was ist ein Rebound?
Unter einem Rebound versteht man die zweite Chance, ein Tor zu erzielen, wenn der Puck vom Torhüter abprallt - oder auch von der Latte oder der Torstange. Die Situation ist an sich ein Angriff oder auch ein Weitschuss, wodurch der Puck möglichst ins Tor fliegen soll. Das tut er aber nicht, weil man die Stange getroffen hat oder weil der Torhüter abwehren konnte. Aber der Puck wird nicht fixiert, sondern er springt auf welche Weise immer zurück ins Spielfeld, und zwar genau zentral vor das Tor.
Wenn dort nun ein weiterer Angreifer steht, hat er für sein Team eine zweite Chance, das Tor doch noch zu erzielen. Deshalb gilt es, den Puck so abzuwehren, dass er zur Seite wegspringt und nicht zentral vor dem Tor quasi serviert wird. Eine solche unfreiwillige Dienstleistung wird Rebound genannt und findet sich auch oft in den Kommentaren der Reporter, die das Spiel kommentieren. Das Fatale daran ist, dass häufig der Torhüter keine Chance auf eine Abwehr hat, weil er noch von der ersten Aktion am Boden liegt.
Plan B gegen den Rebound
Häufig ist zu beobachten, dass der Torhüter den Puck nicht festhält, wenn er unter Kontrolle gebracht wurde, sondern mit dem Schläger zur Seite weiterspielt. Niemals wird er den Puck nach vorne spielen, weil genau, dass die gefährlichen Situationen erst recht auslöst. Und das ist auch der Plan B gegen den Rebound. Der Torhüter kann nicht jeden Schuss fangen und daher gilt es, den Puck mit der Schutzkleidung oder den Schläger so abzuwehren, dass er seitlich vom Tor abprallt. Damit müssen die Angreifer den Puck erst wieder in die Mitte spielen und der Torhüter hat Zeit, sich neu zu positionieren und die Abwehr sollte dann auch wieder einsatzbereit sein.
Aber nicht immer hat man selbst den Spielzug unter Kontrolle, denn ein Schuss von der blauen Linie, der an der Stange landet, führt häufig dazu, dass der Puck zurückspringt und eine Rebound-Chance gegeben ist. Dann gilt es, dass der Verteidiger schneller agiert als der gegnerische Angreifer, um eine Einschussmöglichkeit zu unterbringen.
Shut Out
(kkein Tor zugelassen)
Shutout im Eishockeyspiel
Torhüter kassiert keinen einzigen Treffer
Typisch für den Eishockeysport ist die Tatsache, dass viele Tore fallen können. Das muss zwar nicht zwangsläufig so sein, aber wenn ein Fußballspiel 4:4 endet, fragen sich die Fans oft, ob hier Eishockey gespielt wurde und das ist kein Zufall. Denn die Spielfläche ist viel kleiner und im Eishockey wird auch viel schneller gespielt. Ein Torerfolg kann also auch entsprechend schneller erzielt werden.
Die Ausnahme sind die Entscheidungsspiele. Wenn es um etwas geht, beispielsweise in einem Viertelfinale der Play-Offs oder im Finale der Weltmeisterschaft, dann wird sehr vorsichtig agiert, aber Tore fallen auch dort. Durchaus können solche Entscheidungsspiele nach einem zögerlichen Beginn zu einem Offensivspektakel werden.
Was ist das Shutout im Eishockeyspiel
Und dann gibt es im Eishockeyspiel das Shutout, das dieser Theorie fast widerspricht. Ein Shutout ist ein Begriff für die Leistung des Torhüters und besagt, dass dieser Torhüter während eines Spieles nicht ausgewechselt wurde und kein einziges Tor kassiert hat. Das heißt, es kann sehr wohl viele Tore geben, aber nur für die eigene Mannschaft, die auf jeden Fall zu null gewonnen hat. Natürlich könnte es auch ein 0:0 geben, aber das ist selten und erfordert eine Verlängerung und ein Penaltyschießen.
Gewinnt die Mannschaft mit 2:0, dann hat der Torhüter ein Shutout geschafft und Torhüter, die das mehrfach, vielleicht sogar in Serie schaffen, sind Berühmtheiten. Solche Spieler will man in jeder Mannschaft haben und sie stellen einen starken Rückhalt dar, wobei die Qualität der Verteidigung natürlich auch eine Rolle spielt. Wenn die Verteidiger schon viele Gegenangriffe stoppen können, ist die Gefahr für den Torwart geringer, ein Tor zu kassieren. Dennoch gibt es in jedem Spiel, selbst in vorsichtig geführten Partien, einige Situationen, in denen schnell reagiert werden muss. Ein Shutout ist daher immer etwas Besonderes, das nicht häufig gelingt.
Ein Shutout ist aber nicht gegeben, wenn der Torwart während des Spiels ausgewechselt wurde. Verzweifelt der Torwart nach dem dritten Gegentreffer und lässt sich ersetzen, dann ist also das Shutout nicht gegeben, wenn der Nachfolger keinen Treffer mehr kassiert.
Begriffe Abwehr
Begriffe im Eishockey über die Abwehr
Penalty-Killing und andere Abwehrarbeit
Sehr viele Begriffe wurden rund um den Eishockeysport geschaffen und dazu zählen auch solche, die mit der Abwehrleistung in Zusammenhang stehen. Damit ist nicht die statistische Auswertung gemeint, sondern vor allem die Aktionen selbst wie das berühmte Penalty-Killing als eine wesentliche Abwehrleistung, die aber nicht nur die Verteidiger umfasst.
Eishockeybegriffe zur Abwehr und zu Abwehrreaktionen
Denn beim Unterzahlspiel hat man auch mit den Stürmern Verteidigungsarbeit zu leisten und so beziehen sich die Begriffe in der Eishockeysprache nicht auf bestimmte Spieler selbst, sondern auf das Abwehrverhalten, um ein Gegentor zu vermeiden. Die Abwehr beginnt manchmal in höchster Not erst vor dem eigenen Tor, meist wird die Abwehr aber spätestens bei der blauen Linie durchgeführt, um den Gegner erst gar nicht in das Verteidigungsdrittel zu lassen.
Zahlreiche verschiedene Methoden gibt es daher, wie man die Abwehrarbeit anlegen kann und wie die Taktik geprägt ist. Das ist von Mannschaft zu Mannschaft und von Spieler zu Spieler unterschiedlich und auch das Selbstvertrauen und das Kräfteverhältnis zum Gegner spielt eine Rolle. Die Abwehrleistung wird gegen schwächere Mannschaft viel offensiver angelegt werden als gegen sehr starke Mannschaften, die eine Abwehr leicht ausspielen können.
In diesem Kapitel beziehen sich die Eishockeybegriffe vor allem auf die Abwehrarbeit und auf Fachvokabel, die durch die Liveübertragungen, die Kommentare, aber auch durch die Spielzüge selbst eingeführt wurden und zum Teil sogar sehr bekannt wurden, manche sind sogar in andere Sportarten übernommen worden. Das Unterzahlspiel gibt es in anderen Sportarten auch, aber sicher nicht so oft wie im Eishockeyspiel und so war das Eishockey Vorgabe für andere Sportarten. Das war beim Assist als Torvorlage auch schon so.
Begriffe zur Verteidigung im Eishockey
Unterzahlspiel (auch Penaltykilling)
Beschreibung: Unterzahlspiel oder Penaltykilling
Clearing (raus mit dem Puck aus der Verteidigungszone)
Beschreibung: Clearing
Stay at Home (Verteidiger sichert hinten ab)
Beschreibung: Stay at Home
Unterzahl oder Penaltykilling
(auch Penaltykilling)
Unterzahl im Eishockey
Spielen mit weniger Leute nach Strafe
Penaltykilling ist ein Ausdruck im Eishockeysport, der die Abwehrarbeit der Mannschaft umschreibt, wenn sie in Unterzahl spielen muss. Das ist dann der Fall, wenn eine Strafe ausgesprochen wird und man mit zumindest einem Spieler weniger auf dem Eis steht. Der Gegner möchte diese zahlenmäßige Überlegenheit ausnutzen und leichter zu einem Torerfolg kommen.
Was ist das Unterzahlspiel im Eishockey?
Wird ein Spieler einer Mannschaft bestraft und findet sich auf der Strafbank wieder, dann muss sein Team mit weniger Spieler auskommen. Das Spiel selbst bei einer numerischen Unterlegenheit wird als Unterzahl oder Unterzahlspiel bezeichnet. Es dokumentiert damit, dass es kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den beiden Mannschaften gibt, wobei es meist so ist, dass eine Mannschaft die üblichen fünf Feldspieler zur Verfügung hat, die bestrafte Mannschaft aber nur vier. In ganz kritischen Situationen kann es auch sein, dass es eine 5:3-Situation gibt, weil zwei Spieler auf der Strafbank Platz nehmen mussten.
Das Unterzahlspiel bedeutet, dass man die Räume rund um das eigene Tor eng macht, um möglichst wenige Torchancen und Torschüsse zuzulassen. Das erfordert ein eingespieltes Team und Routine, damit jeder Abwehrspieler und die zu Hilfe geeilten Stürmer weiß, was er zu tun hat und sich darauf verlassen kann, dass die Mitspieler auch ihren Job machen. Andernfalls würde die Unterzahl so aussehen, dass gleich zwei Spieler einen Angreifer bedrängen, während eine große Lücke in der Verteidigung gerissen wird. Mit einem schnellen Pass zum Mitspieler kann der Angreifer diese Situation ausnutzen und für eine große Chance sorgen.
Es erfordert daher viel Disziplin, um seine Position zu halten und gleichzeitig die Angreifer nicht zum Zug kommen zu lassen. Noch besser ist es natürlich, wenn es überhaupt nicht zu einer Strafe kommt und man daher gar nicht erst in die Unterzahlsituation gelangt. Ganz übel wird es, wenn eine 5-Minuten-Strafe ausgesprochen wird, weil man dann auch in der Unterzahl bleibt, wenn der Gegner ein Tor erzielen konnte. Normalerweise wird mit einem Tor das Unterzahlspiel aufgehoben und der bestrafte Spieler darf wieder die Eisfläche betreten.
Penaltykilling im Eishockeyspiel
Abwehrarbeit in Unterzahl nach Bestrafung
Wenn im Eishockeymatch eine Strafe ausgesprochen wird, dann wird eine der beiden Mannschaften geschwächt - bei einer Boxeinlage vielleicht aber auch beide Mannschaften. Geht man nun davon aus, dass nur eine Mannschaft geschwächt wird, dann findet sich deren Spieler auf der Strafbank ein und das Team muss mit einem Mann weniger weiterspielen, und zwar so lange, bis entweder die Strafe von üblicherweise zwei Minuten abgelaufen ist oder der Gegner ein Tor schießen konnte.nn
Was ist das Penaltykilling?
Der Penalty ist die auferlegte Strafe und damit entsteht je nach Sichtweise ein Überzahlspiel oder ein Unterzahlspiel. Die bestrafte Mannschaft spielt in der Unterzahl und ist auf der Eisfläche damit zahlenmäßig unterlegen, weshalb man vielen Angriffen des Gegners in der eigenen Verteidigungszone ausgesetzt ist. Das bedeutet, dass man sich rund um das Tor postiert und versucht, den Gegner nicht zum Torschuss kommen zu lassen. Der Gegner wiederum hat das Ziel, die Überzahl für einen Torerfolg zu nutzen.
Die Abwehrarbeit wird im Eishockeysport in solch einer Situation als Penaltykilling bezeichnet. Das zahlenmäßig unterlegene Team versucht also die Chance des Gegners zu zerstören, indem man die Positionen rund um das Tor besetzt und auf eine Gelegenheit wartet, um an den Puck zu kommen und diesen über die blaue Linie zu befördern. Denn dann müssen die gegnerischen Spieler das Angriffsdrittel aus ihrer Sicht verlassen und einen neuen Angriff aufbauen. Ein erfolgreiches Penaltykilling bedeutet, dass man die Strafe ohne Gegentor überstehen konnte.
Mannschaften, die besonders häufig im Penaltykilling bestehen können, werden auch medial hochgelobt und haben den Respekt des Gegners, der bei seinen Angriffsbemühungen vielleicht ein Stück vorsichtiger agieren, was für die Abwehrarbeit hilfreich sein kann. Es gibt aber natürlich auch das Gegenteil und Mannschaften, die beim Penaltykilling oft am falschen Posten stehen und gerade dann viele Tore kassieren. In dem Fall freut sich der Gegner auf die Situationen, wobei man mit gezieltem Training die Fehler auch beheben kann.
Bedeutung des Penaltykilling
Da es im Eishockeyspiel immer wieder Strafen gibt, ist das Überzahlspiel oder aus Sicht der benachteiligten Mannschaft das Penaltykilling immer wieder anzutreffen. Welch große Bedeutung diese Situation hat, erkennt man auch daran, dass etwa bei einem WM-Turnier immer wieder von der Quote die Rede ist. Das kann die Quote einer Mannschaft sein, wie viele Tore sie im Powerplay erzielen konnte oder umgekehrt, wie viele Strafzeiten man ohne Gegentor überstehen konnte. Damit kann man auch die Effizienz einer Mannschaft in Zahlen ausdrücken.
Clearing
(raus mit deem Puck aaus der Verteidigungszone)
Clearing in der Eishockeyverteidigung
Puck aus der Gefahrenzone bringen
Die gegnerische Mannschaft kann im Eishockeyspiel nur dann ein Tor erzielen, wenn sich der Puck im Angriffsdrittel befindet. Aus dem Mitteldrittel heraus darf kein Tor geschossen werden. Das bedeutet für die Verteidiger, dass sie dieses Drittel, das aus ihrer Sicht das Verteidigungsdrittel ist, sauber halten müssen. Der Puck muss so schnell wie möglich wieder über die blaue Linie hinausgespielt werden und das bezeichnet man als Clearing.
Was bedeutet Clearing?
Clearing oder Clearing the zone ist ein bekannter Begriff in der englischen Eishockeysprache und beschreibt die Bemühungen, den Puck zu entsorgen und damit aus dem eigenen Verteidigungsdrittel zu spielen. Das gilt ganz besonders im Falle eines Powerplays, wenn man als unterlegene Mannschaft unter Druck gerät und dann muss der Puck über die blaue Linie gespielt werden, damit der Gegner alle Spieler aus der Angriffszone bringen muss, um einen neuen Angriff aufzubauen. Das kostet Zeit und die Abwehr hat ein paar Sekunden Luft, um sic wieder zu sammeln.
Doch auch während normaler Aktionen ist das Clearing ein Thema, wenn ein Konter gespielt wird und man als Verteidiger den Puck schnell aus dem Verteidigungsdrittel spielt, damit der Angriff unterbunden wird. Der Unterschied zwischen dem Unterzahlspiel und einer normalen Aktion ist aber die Regel vom unerlaubten Weitschuss. Beim Powerplay gibt es die Regel nicht, bei normalen Spielsituationen hingegen schon, weshalb der Schuss über zwei Linien zu einem Bully im eigenen Verteidigungsdrittel führt und damit die Gefahr erst recht wieder erhöht.
Das heißt, dass der Puck, den man eigentlich entsorgen wollte, schon wieder im Verteidigungsbereich zu finden ist und die Gefahr ist sogar noch größer geworden. Hat man aber mit dem unerlaubten Weitschuss eine gefährliche Angriffsaktion unterbunden, war es den unerlaubten Weitschuss auf alle Fälle wert und man hat ein gutes Clearing hinbekommen. Je weiter der Puck vom eigenen Tor weg ist, desto sicherer kann man agieren und das gilt für alle Eishockeymannschaften.
Stay at Home
(raus mit deem Puck aaus der Verteidigungszone)
Stay at Home im Eishockeyspiel
Verteidiger rückt nicht in den Angriff auf
Im Gegensatz zu anderen Sportarten wie dem Fußball der Wechsel zwischen Verteidiger und Angreifer im Eishockeysport sehr kurzfristig anzusehen, das bedeutet, dass ein Angreifer binnen von Sekunden zum Verteidiger wird und umgekehrt. Es gibt aber Spieler, die besondere Aufgaben haben und für solche hat man auch besondere Begriffe entwickelt. Ein Beispiel ist Stay at Home.
Was bedeutet Stay at Home im EIshockey?
Übersetzt heißt Stay at Home natürlich, dass man zu Hause bleibt und das ist im Eishockeysport so zu verstehen, dass man beim Gegenangriff der eigenen Mannschaft nicht aufrückt. Gemeint ist mit dem Begriff ein Verteidiger, der nicht mit den Stürmern zusammen eine Torchance erarbeiten will, sondern darauf achtet, dass nichts passiert, wenn die gegnerische Mannschaft den Puck erkämpfen sollte. In diesem Fall ist der Verteidiger die letzte Chance zur Gegenwehr, bevor der gegnerische Spieler vor dem Torwart steht.
Das bedeutet aber nicht, dass der Verteidiger gar keine offensiven Aktionen zeigt. Im Powerplay ist er genauso an der blauen Linie zu finden wie der andere Verteidiger und versucht per Weitschuss sein Glück, aber im normalen Spielablauf ist er jener, der für die Sicherheit in der eigenen Verteidigungszone sorgt und auf ihn kann man sich verlassen. Dabei gibt es auch Absprachen und Wechsel unter den Verteidigern, sodass je nach Spielsituation mal der linke und mal der rechte Verteidiger einen Ausflug wagt und in den Angriff übergeht, wobei er weiß, dass sein Verteidigungspartner hinten sichert, falls beim Angriff etwas schiefgehen sollte.
Absicherung nach hinten
Stay at Home ist damit ein Begriff, den man für verschiedene Sportarten wählen kann, auch für den Fußball, wenn ein Verteidiger hinten absichert, während alle anderen angreifen. Im Eishockeysport sind es sehr schnell wechselnde Situationen, die die Mannschaften vorfinden und wenn man hinten nicht einen Verteidiger als Bollwerk stehen hat, kann das rasch fatal sein, obwohl man gerade erst selbst in den Angriff übergegangen ist.
Es gibt auch die lockerere Version, dass ein Verteidiger an der blauen Linie des Angriffsdrittels agiert, die drei Stürmer versuchen den Torerfolg und der zweite Verteidiger bewegt sich in der neutralen Zone. Damit ist er nicht im Verteidigungsdrittel, aber nahe genug, um sofort vor dem Tor auszuhelfen.
Begriffe Angriff
Begrifffe im Eishockey über den Angriff
Powerplay, Konter und andere offensive Aktionen
So wie für alle Situationen im Eishockeyspiel gibt es auch für den Angriff und somit für die offensiven Aktionen Begriffe, die für das Eishockeyspiel typisch sind, aber für Einsteiger nicht immer gleich zu verstehen sind. Vor allem viele englische Begriffe haben sich durch die Tradition des Sports in den USA und in Kanada entwickelt.
Angriff und zu Angriffsaktionen im Eishockeyspiel
Der bekannteste Begriff ist natürlich das Powerplay, das man als Überzahlspiel übersetzen kann und das in einem Eishockeyspiel oft anzutreffen ist. Dabei muss die zahlenmäßig unterlegene Mannschaft versuchen, ohne Gegentreffer über die Zeit zu kommen, während die gegnerische Mannschaft ihre Angriffsbemühungen noch zusätzlich verstärkt und die Situation ausnutzen will. Das bedeutet auch, dass die Verteidiger mitwirken und viel Druck auf den Gegner ausgeübt wird.
Aber dies ist nicht der einzige Begriff. Viele Umschreibungen von Spielsituationen, wie sie im Eishockeymatch anzutreffen sind, werden mit kurzen Begriffen zusammengefasst. Three to one ist so ein Beispiel, bei dem im Rahmen eines Konters drei Angreifer auf das gegnerische Tor stürmen und dabei nur einen Verteidiger als Gegenwehr vor sich haben. Auch dies ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu einem Torerfolg zu kommen.
Auf diese und ähnliche Weise werden mit den Begriffen verschiedene Spielsituationen umschrieben, die immer wieder entstehen können und die zum Teil auch spielentscheidend sind. Das reicht vom Ugly Goal bis zum Forechecking. Ob es sich um Konter handelt oder um ganz spezielle Tore, mit denen man nicht rechnen konnte, ist dabei nicht so wichtig. Die Begriffe prägten sich schnell im Eishockeysport ein, werden von den Kommentatoren bei Live-Übertragungen oder bei Zusammenfassungen im Fernsehen verwendet und sind den Fans natürlich längst bekannt. Die Begriffe sind auch als Gegenteil der Begriffe vielfach zu verstehen, die für die Abwehr geschaffen wurden. Aus Sicht der Verteidigung ist das Überzahlspiel ein Unterzahlspiel - gleiche Spielsituation, aber anderer Begriff.
Begriffe zum Thema Angriff
Im Eishockeyspiel haben sich viele Begriffe herausgebildet - wohl auch wegen der vielen Übertragungen, die weltweit zu sehen sind. Dabei gibt es verschiedene Situationen. Überzahl und Unterzahl sowie die schnellen Gegenangriffe sind eine Möglichkeit.
- Breakaway oder Konter: der schnelle Gegenangriff
- Shorthander: Tor mist als Konter in Unterzahl
- Powerplay: Angriff in Überzahl
- Three to one: Gegenangriff mit 3:1 Überlegenheit
Und dann gibt es zahlreiche Begriffe rund um den Torerfolg selbst und seine Entstehung sowie die Taktik der Angreifer.
- Blueliner: Tor von der blauen Linie
- Coast to coast: schnelles Offensivspiel mit rasch wechselnden Situationen
- Dump ´n´ Chase: Puck tief in die andere Hälfte spielen
- Empty Net Goal: Torerfolg am Ende des Spiels dank leerem Gegentor
- Forechecking: offensive Spielweise
- Gamewinning Goal: das Siegestor im Spiel
- Onetimer: Puck wird direkt zum Schuss übernommen
- Penalty und Penaltyschießen - auch Shootout
- Schlittschuhtor: Tor mit dem Schlittschuh, das nicht zählt
- Ugly Goal oder schmutziges Tor: Tor nach Herumgestocher
Begriffe zur Offensive im Eishockey
Konter (schneller Gegenangriff)
Beschreibung: Konter oder Breakaway
Three to one (drei greifen an, nur einer im Weg)
Beschreibung: Three to one
Shorthander (Tor in Unterzahl)
Beschreibung: Shorthander
Powerplay (zahlenmäßige Überlegenheit)
Beschreibung: Powerplay
Blueliner (Tor von der blauen Linie)
Beschreibung: Blueliner
Ugly Goal (schmutziges Tor)
Beschreibung: Ugly Goal
Forechecking (Gegner früh stören)
Beschreibung: Forechecking
Dump 'n' Chase (offensive Spielweise)
Beschreibung: Dump 'n' Chase
Penalty (auch Penaltyschießen)
Beschreibung: Penalty und dem Penaltyschießen
Empty Net Goal (ins leere Tor schießen)
Beschreibung: Empty Net Goal
Konter oder Breakaway
(schneller Angriff)
Konter oder Konterangriff im Eishockeyspiel
Rascher Gegenangriff nach Angriff des Gegners
Der Konter oder auch Konterangriff ist ein Spielzug, den es in vielen Mannschaftssportarten, aber selbst als Begriff in Einzelsportarten wie dem Tennis gibt. Dabei reagiert man auf einen Angriff des Gegners mit einem überraschenden Gegenangriff und bei einer so schnellen Sportart wie Eishockey ist dies ein wirklich rasch vorgetragener Spielzug.
Was ist der Konter im Eishockey?
Die Grundlage für den Konter ist das Team A, das einen Angriff vorträgt und das Team B in die Defensive zwingt. Die Idee ist, ein Tor zu erzielen und man ist über die Durchführung im Klaren und auch überzeugt davon, erfolgreich sein zu können. Team B kann aber in so einem Fall glücklich oder gekonnt an die Scheibe kommen und rasch einen Gegenangriff einleiten. Da Team A in der Offensive und somit Vorwärtsbewegung war, gibt es viel Platz in deren Verteidigungsdrittel.
Hat man nun schnelle Leute zur Stelle, dann kann man einen langen Pass zum Angreifer spielen und dieser versucht den Platz zu nutzen. Bei sehr unvorsichtiger Offensive von Team A kann es sogar passieren, dass man überhaupt keine Verteidigung vorfindet und dann hat man nur noch den Torhüter vor sich, der ein Wunder vollbringen muss, um den Treffer zu vermeiden.
Der Konter ist insofern auch im Fußball oder Handball fatal, weil man selbst gedanklich im Angriffsverhalten war und plötzlich umschalten muss. Hat man sich aber zu weit nach vorne gewagt, kann das nicht immer gleich korrigiert werden, dann passt die Redewendung, dass man "am falschen Fuß" erwischt wurde. Gerade beim Versuch, einen Rückstand aufzuholen, sind die Spieler sehr bemüht, einen massiven Angriff zu zeigen, aber die Verteidiger müssen immer aufpassen, dass sie nicht Opfer eines Gegenangriffs werden.
Expperten für Konter
Es gibt sogenannte Experten für den Gegenangriff, die sich darauf spezialisiert haben. Das sind Teams, die offensiv keine großartigen Spielzüge zeigen oder zeigen können, aber wenn der Gegner aufgerückt ist und man die Scheibe erobern kann, kann man diesen starken Gegner leichter ausspielen, weil mehr Platz vorhanden ist.
Solche Vereine kennt man, gegen sie ist schwer zu spielen, weil man ja doch angreifen muss. Da aber auch nicht immer ein Konter möglich ist und selbst wenn, dieser nicht immer erfolgreich abgeschlossen wird, ist es eine Taktik mit wechselhaftem Glück.
Breakaway im Eishockeyspiel
Der schnelle und gefürchtete Konterangriff
Den Konterangriff gibt es in vielen Sportarten vom Fußball bis zum Tennis oder Tischtennis und natürlich auch im Eishockeysport. Als Konterangriff bezeichnet man eine Aktion, bei der der Gegner in die Offensive geht und einen Angriff aufbaut. Seine Spieler sind in der Vorwärtsbewegung und möchten die Gegenspieler unter Druck setzen. Doch dann kommt es zu einem Puckverlust und es folgt ein schneller Gegenangriff, eben ein Konter.
Was ist ein Breakaway im Eishockey?
Der Konter wird bei den Eishockeybegriffen als Breakaway aus dem englischen Sprachgebrauch bezeichnet. Gerade durch die überschaubare Dimension der Eisfläche und der schnellen Möglichkeit, diese zu überwinden, ist der Konterangriff sehr gefährlich. Wenn man den eigenen Angriff nur mit zwei Spielern durchführt, wird man wenig erreichen können, aber wenn man mit der gesamten Mannschaft angreift, kann man schnell in einen Konter laufen.
Team A greift zum Beispiel mit vier Leuten an und es kommt zu einem Missverständnis, wodurch Team B den Puck besitzt. Wenn diese schnell schaltet, kann sie mit wenigen Pässen einen Gegenangriff einleiten, bei dem ursprünglich nur ein Verteidiger und der Torwart im Weg sind. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit für einen erfolgreichen Angriff mit Torabschluss. Natürlich laufen die Spieler von Team A schnell zurück, daher muss der Konterangriff oder das Breakaway zügig ausgeführt werden, um effektiv sein zu können.
Die Kunst im Angriff beim Eishockey besteht darin, den Gegner unter Druck zu setzen und trotzdem nicht anfällig für Konter zu sein. Das ist aber nicht möglich und so kommt es in jedem Eishockeyspiel zu Breakaways, bei denen man nur hoffen kann, dass der Torhüter einen guten Tag hat und die Aktion unterbindet. Es ist auch nicht so einfach, diesen schnellen Angriff erfolgreich abzuschließen, denn man läuft samt Puck sehr schnell Richtung gegnerisches Tor, weiß die Abwehrspieler hinter sich heranstürmen und muss dennoch präzise zielen und schießen.
Three to One
(drei Greifen an, nur einer im Weg)
Three to One im Eishockeyspiel
Konterangriff mit klarer Torchance durch 3 gegen 1
Zu den zahlreichen Begriffen rund um den Angriff im Eishockeyspiel zählt auch jener vom Three-to-one, was übersetzt Drei gegen Einen bedeutet und eine solche Spielsituation ist immer bei einem Konterangriff möglich, wenn eine Mannschaft zu weit aufgerückt ist und ihre Verteidigung entblößt.
Was ist Threee to One im Eishockeyspiel?
Three to one kann dann entstehen, wenn Mannschaft A in den Angriff übergeht und fast die ganze Mannschaft sich in das Angriffsdrittel wagt oder zumindest am Weg dorthin ist. Der Puck wird aber schnell an einen Spieler der Mannschaft B verloren, der ihn sofort tief in seine Angriffszone spielt, um einen Mitspieler in Aktion zu bringen. Dieser läuft den Puck nach und hat nun nur einen Verteidiger vor sich, aber zwei weitere Mitspieler haben die Situation schnell erkannt und sind mitgelaufen. Damit gibt es drei Angreifer, die nur einen Verteidiger und den Torhüter vor sich haben.
as Problem bei einem solchen Konterangriff besteht meist darin, dass man zum einen sehr schnell den Spielzug abschließen muss, bevor die ganze Verteidigung anrückt und zum anderen nicht nachdenken darf. Häufig passiert es einem Angreifer, dass er darüber nachdenkt, was zu tun ist. Soll er zum Mitspieler 1 oder zum Mitspieler 2 passen? Oder soll er einen Schuss wagen oder den Verteidiger überspielen? Da viel Platz besteht, gibt es auch mehr Möglichkeiten, als man normalerweise zur Verfügung hat und die Versuchung ist groß, dass man dann ins Grübeln kommt, was zu tun ist.
Wer mit Instinkt und schnell die Aktion ausführt, ist meistens auf der sicheren Seite, wobei der Torhüter viele solcher Situationen auch entschärfen kann, aber ein Konterangriff in der Version Three on one ist eine hervorragende Torchance, die man nicht leichtfertig vergeben sollte. Wenn allerdings der Verteidiger den Angriff stoppen kann - ist er der Held.
Verteidiger bei Three to One
Es gibt nicht nur die offensive Seite und die Gefahr, dass man zu lange nachdenkt, weil man völlig überrascht wurde. Auch der Verteidiger muss sich schnell entscheiden. Er kann direkt auf den aktiven Spieler losgehen, um ihn aufzuhalten. Spielt der dann zum Mitspieler, ist der Verteidiger nicht mehr zur Stelle. Hält der Verteidiger aber den Stürmer auf und entschärft die Situation, dann ist er der große Gewinner der Aktion.
In solchen Situationen brauchen alle Beteiligten Instinkt, Erfahrung und eine schnelle Entscheidungsbereitschaft. Das gilt auch für den Torhüter, der sich überlegen muss, wie er sich orientiert.
Shorthander
(Tor in Unterzahl)
Shorthander im Eishockeyspiel
Eishockeytor in Unterzahl gelungen
Das Powerplay ist eine schöne Möglichkeit für eine Mannschaft im Eishockey, um durch die Überzahlsituation ein Tor zu erzielen. Man hat einen Spieler oder vielleicht sogar zwei mehr auf dem Eis als der Gegner und setzt ihn unter Druck. Das bedeutet auch, dass man sich vollständig in dessen Verteidigungszone bewegt, um den Druck weiter zu erhöhen und bei erstbester Gelegenheit auf das Tor schießen wird, um zum Erfolg zu kommen.
Was ist der Shorthander im Eishockey?
Das Powerplay ist die zahlenmäßige Überlegenheit einer Mannschaft, weil der Gegner zumindest einen Mitspieler auf der Strafbank sitzen hat. Ziel ist ein Torerfolg dank der Überlegenheit. Bekommt man aber in dieser Phase überraschend einen Gegentreffer der unterlegenen Mannschaft, dann wird dieses Tor Shorthander bezeichnet, oftmals SH abgekürzt - etwa im Spielbericht.
Man geht davon aus, dass beim Powerplay die zahlenmäßig überlegene Mannschaft den Torerfolg erzielen wird, der Shorthander passiert - vielleicht sogar öfter als man glaubt - ist aber trotzdem eine Besonderheit. Ganz ungewöhnlich ist es, wenn ein Shorthander einer Mannschaft in einem Spiel mehrfach gelingt.
Ist dies der Fall, dann muss sich die angreifende Mannschaft gründlich überlegen, was dabei schiefgegangen ist, dass man aus dem Vorteil des Powerplay den Nachteil des Shorthanders erntet. Es gibt natürlich Spieler, die nur darauf warten, den Puck abzufangen und einen Gegenangriff zu starten. Üblicherweise schießt man den Puck nur aus der Gefahrenzone, um Zeit zu sparen, aber manche Konterspieler haben es sich zur Spezialität gemacht, einen Gegenangriff zu wagen.
Das Risiko dabei ist, dass man aus seiner Verteidigungsposition offensiver herausrücken muss, um überhaupt an den Puck heranzukommen. Und das wiederum bedeutet, dass man seine Verteidigung entblößt und dem Gegner mehr Möglichkeiten zum Torschuss einräumt.
Shorthander im Eishockeyspiel
Der Shorthander ist eine Situation, die manchmal passiert, manchmal aber in einem Spiel mehrfach und dann ist es schon ungewöhnlich. Die Grundvoraussetzung für ein gelungenes Powerplay ist ein eingespieltes Team, das die Laufwege kennt. Wenn die Spieler nun Opfer von Missverständnissen werden, kann der Puck leichter abgefangen werden und dann ist die Gefahr groß, dass man einen Shorthander probiert. Das hängt aber auch von der Situation ab. Wenn man vor sich noch einen Gegenspieler hat, wird man den Puck nur aus dem Drittel schießen, andernfalls wird man den Angriff wagen und schauen, wie weit man kommt. Kommt man wirklich bis zum Torhüter des Gegners, dann versucht man natürlich, einen Treffer zu erzielen, was einer Penalty-Situation gleich kommt.
Eine komplett ungewöhnliche und umso bemerkenswertere Aktion gelingt dann, wenn zwei Spieler auf der Strafbank Platz genommen haben und der Gegner damit eine 5:3 Überlegenheit an Spielern hat. Wenn man dann nur noch zu dritt ist, massiv unter Druck steht und einen Shorthander schafft, dann ist das außergewöhnlich und passiert wirklich sehr selten. Weil der kleinste Fehler reicht bereits und man kassiert selbst ein Tor und daher ist die Verteidigungsarbeit noch wichtiger. Hat man dann den Mut, eine offensive Aktion zu wagen und kann sie erfolgreich abschließen, dann ist man der Held - für einen kurzen Augenblick zumindest.Der Shorthander ist eine Situation, die manchmal passiert, manchmal aber in einem Spiel mehrfach und dann ist es schon ungewöhnlich. Die Grundvoraussetzung für ein gelungenes Powerplay ist ein eingespieltes Team, das die Laufwege kennt. Wenn die Spieler nun Opfer von Missverständnissen werden, kann der Puck leichter abgefangen werden und dann ist die Gefahr groß, dass man einen Shorthander probiert. Das hängt aber auch von der Situation ab. Wenn man vor sich noch einen Gegenspieler hat, wird man den Puck nur aus dem Drittel schießen, andernfalls wird man den Angriff wagen und schauen, wie weit man kommt. Kommt man wirklich bis zum Torhüter des Gegners, dann versucht man natürlich, einen Treffer zu erzielen, was einer Penalty-Situation gleich kommt.
Eine komplett ungewöhnliche und umso bemerkenswertere Aktion gelingt dann, wenn zwei Spieler auf der Strafbank Platz genommen haben und der Gegner damit eine 5:3 Überlegenheit an Spielern hat. Wenn man dann nur noch zu dritt ist, massiv unter Druck steht und einen Shorthander schafft, dann ist das außergewöhnlich und passiert wirklich sehr selten. Weil der kleinste Fehler reicht bereits und man kassiert selbst ein Tor und daher ist die Verteidigungsarbeit noch wichtiger. Hat man dann den Mut, eine offensive Aktion zu wagen und kann sie erfolgreich abschließen, dann ist man der Held - für einen kurzen Augenblick zumindest.
Powerplay
(zahlenmäßige Überlegenheit)
Powerplay im Eishockeyspiel
Überzahlspiel im Eishockeyspiel nach Strafe
Es gibt eine Reihe von Begriffen im Eishockeysport, die eigentlich nur die Fans kennen und nicht Leute, die kaum mit diesem Sport in Berührung kommen. Es gibt aber auch ein paar Begriffe, die über den Eishockeysport hinaus bekannt geworden sind und zum Teil auch übernommen wurden. Powerplay ist sicher einer dieser bekannten Begriffe.
Was ist das Powerplay im Eishockey?
Als Powerplay bezeichnet man im Eishockey eine Spielsituation, in der eine Mannschaft um zumindest einen Spieler mehr auf dem Eis zur Verfügung hat als die andere Mannschaft. Vorausgegangen ist eine regelwidrige Handlung der numerisch geschwächten Mannschaft, sei es ein Wechselfehler, weswegen ein Spieler zu viel auf dem Eis war oder ein Foulspiel. In all diesen Fällen muss ein Spieler auf die Strafbank und die Folge ist die numerische Unterlegenheit.
Bedeutung des Powerplay im Eishockey
Powerplay lässt sich mit Kraftspiel übersetzen, das trifft aber nicht ganz die Spielsituation. Es geht im Powerplay wohl darum, mit viel Energie den Versuch zu unternehmen, dem Gegner ein Tor zu schießen und es ist eine gute Gelegenheit dazu, weil man mehr Spieler einsetzen kann, aber die Kraft alleine hilft nicht weiter.
Eine typische Situation im Eishockey entsteht dann, wenn ein Spieler auf der Strafbank sitzt und fünf Feldspieler einer Mannschaft (der sechste ist der Torhüter) gegen vier Feldspieler des Gegners antreten. Das Spiel wird schnell in die Verteidigungszone des Gegners verlegt und durch geschicktes und schnelles Kombinationsspiel sucht die angreifende Mannschaft die Lücke, durch die ein Torschuss zum Erfolg führen könnte. Man setzt den Gegner unter Druck und möchte schnell zum Torerfolg kommen.
Wer durch eine Strafe geschwächt wurde, weiß sofort, was passieren wird. Die zahlenmäßig unterlegene Mannschaft zählt nur noch die Sekunden, bis der Kollege von der Strafbank zurückkehren darf, die Angreifer möchten hingegen sofort auf den Torerfolg losgehen und die Situation nutzen.
Die Verteidiger versuchen, ein Quadrat aufzustellen. Alle vier Verteidiger stehen zueinander wie die Eckpunkte eines Quadrates und verschieben je nach Spielsituation seitlich zueinander, sodass vor dem eigenen Tor kaum Platz für einen Torschuss bleibt. Gelingt das Tor dennoch, ist das Powerplay aufgehoben, denn der bestrafte Spieler darf wieder das Eis betreten. Ausnahme sind Strafen nach schweren Vergehen. Bei einer Fünf-Minuten-Straße zum Beispiel bleibt der Spieler auch nach einem Treffer auf der Strafbank, bis die Zeit abgelaufen ist.
Gute Gelegenheit im Spiel
Das Powerplay ist natürlich nicht die einzige Gelegenheit, um zum Torerfolg zu kommen, aber es gibt auf Vereinsebene und auch bei Nationalmannschaften Teams, die Spezialisten sind, wenn es um den Torerfolg bei Überzahl geht und auch Teams, die besonders wenige Tore in Unterzahl zulassen.
Obwohl mit viel Technik und Kombinationsspiel Erfolge im Powerplay erzielt werden können, ist es aber vor allem der Druck, der auf die Verteidiger ausgeübt wird, der das Spiel im Powerplay auszeichnet. Dieser Druck auf die gegnerische Abwehrlinie ist auch der Grund, warum der Begriff abseits des Eishockeys gerne verwendet wird, beispielsweise im Fußball oder Handball, wenn eine Mannschaft den Gegner stark unter Druck setzt.
Im Eishockeyspiel ist das Powerplay eine gute Gelegenheit für ein Tor und eine doch häufiger anzutreffende Variante, weshalb es wichtig ist, dass man auch torgefährliche Abwehrspieler in den eigenen Reihen hat, die von der blauen Linie aus das Tor angreifen können. Nicht nur die Stürmer sind gefragt, sondern auch die Verteidiger und man braucht ein eingespieltes Team, denn bei einem Fehlpass kann man schnell in einen Konter laufen und handelt sich einen Shorthander ein - ein Tor, das eine Mannschaft in Unterzahl schießen konnte.
Blueliner
(Tor von der blauen Linie)
Blueliner im Eishockeyspiel
Spieler an der blauen Linie
Viel öfter als im Fußballspiel ist im Eishockeyspiel ein Verteidiger auch gleichzeitig ein Angreifer. Diese Funktion füllt er vor allem im Powerplay-Spiel aus, wenn man in der Überzahl im Angriffsdrittel sich festsetzen konnte und die Verteidiger aufrücken, um von der blauen Linie aus für Gefahr zu sorgen und so entstand auch der Ausdruck des Blueliner.
Was ist ein Blueliner?
Ein Blueliner ist demnach ein Verteidiger, der an der blauen Linie auf den Puck wartet, um mit einem Weitschuss sein Glück zu versuchen. Es muss nicht unbedingt ein Überzahlspiel sein, auch während eine Angriffsaktion, bei der der Verteidiger mit aufgerückt ist, kann er an der blauen Linie auf den Pass warten, um zum Schuss anzusetzen. Damit ist er ein offensiver und sehr gefährlicher Spieler, denn das Geschoss mit über 100 km/h ist für jeden Torhüter eine Herausforderung.
Blueliner ist aber auch ein Beispiel für die Gruppe der Eishockeybegriffe, die unterschiedlich eingesetzt werden. Denn als Blueliner kann man auch den Schuss selbst bezeichnen, der von der blauen Linie aus durchgeführt wurde und nicht nur den Spieler, der diese Position eingenommen hatte. Umschrieben sind damit gefährliche offensive Aktionen, die durch die Wucht der Schüsse für große Bedrängnis für das verteidigende Team sorgen und die auch schwer zu verteidigen sind, denn wenn man aufrückt, um an der blauen Linie für Entwarnung zu sorgen, entblößt man den Bereich vor dem Tor und dort wartet der Mittelstürmer nur auf den Pass, um zum Torschuss anzusetzen.
Somit ist gerade angesichts der Geschwindigkeit des Eishockeyspiels es schwierig, alle Gefahrenmomente zu entschärfen. Bei einem Powerplay bleibt der Verteidigung nur die Option, sich in die Schüsse zu werfen, die Angreifer haben hingegen viele Optionen. Sie können zurück zur blauen Linie spielen, um über Weitschüsse das Glück zu versuchen oder sie können von der blauen Linie per direktem Pass den Mittelstürmer integrieren, um so zum Torerfolg zu kommen.
Ugly Goal
(schmutziges Tor)
Ugly Goal im Eishockeyspiel
Tor nach Herumgestocher erzielt
Eine Eishockeymannschaft freut sich über jeden Treffer, der im Spiel gelingt, aber die Tore werden von objektiver Seite her unterschiedlich wahrgenommen. Beeindruckt ist man von einer schönen und schnellen Kombination, die mit einem Tor erfolgreich abgeschlossen werden kann, beeindruckend kann auch ein Schuss von der blauen Linie sein oder ein Tor nach einem Dribbling. Weniger beeindruckend ist das Ugly goal.
Was versteht man unter einem Ugly Goal?
Das Ugly goal ist ein Begriff der Kommentatoren, der Fans, aber auch der Spieler selbst und lässt sich als "hässliches Tor" übersetzen. Das Tor ist im Ergebnis genauso viel wert wie jedes andere Tor, aber die Entstehung ist weniger gelungen, wobei es zwei Gruppen von Treffer geben kann, die im Rahmen eines Eishockeyspiels entstehen können. Die erste Gruppe sind einmal die Zufallstreffer, wobei es meist abgefälschte Tore sind. Das heißt, dass ein Spieler den Puck auf das Tor abgibt und irgendwie wird der Puck abgelenkt, sei es durch einen Abwehrspieler oder sei des durch den eigenen Mitspieler, der noch seine Schaufel dazwischen gehalten hat.
Die andere Gruppe ist eigentlich der Ursprung dieses Begriffs, weil es handelt sich dabei um Spielsituationen, in denen ein Gestocher stattfindet. Es kann sein, dass ein Spieler einen Schuss auf das Tor abgegeben hat und der Torhüter konnte abwehren, aber den Puck nicht fixieren. Durch die Abwehr ist er nicht weit geflogen und so haben Angreifer und Abwehrspieler gleichermaßen die Möglichkeit, den Puck unter Kontrolle zu bringen. Damit gibt es einen Kampf um die Gummischeibe unmittelbar vor dem Tor und es kann sein, dass der Puck ganz langsam, wie in Zeitlupe, in das Tor rutscht, während ein halbes Dutzend Eishockeyspieler inklusive Torwart um die Scheibe kämpfen.
Da hier keine schöne Aktion ausgeht, sondern durch ein Gerangel das Tor erzielt wurde, wird ein solcher Treffer als Ugly Goal bezeichnet. Das Tor ist ein Erfolg und wird bejubelt, aber einen Preis wird man für die Entstehung aber nicht erhalten können. Dahinter steht natürlich der Wunsch nach schönen und gelungenen Aktionen, aber das ist nicht immer möglich. Das Herumgestocher kennt man auch vom Fußballspiel oder anderen Sportarten, wenn viele Leute auf kleiner Fläche um das Spielgerät kämpfen.
Forechecking
(Gegner früh stören)
Forechecking im Eishockeyspiel
Frühes Stören des Gegners zwecks Druckaufbau
Das Eishockeyspiel kann auf verschiedene Art und Weise aufgebaut werden. Man kann sehr defensiv agieren und erwartet den Gegner im eigenen Verteidigungsdrittel, wobei man dort die Möglichkeiten einschränkt und den Platz knapp werden lässt. Spielzüge sind für die Angreifer in so einem Fall nicht so einfach aufzubauen. Die Alternative ist eine sehr offensive Auslegung, wie das Forechecking.
Was ist das Forechecking im Eishockey?
Forechecking lässt sich mit frühem Stören übersetzen und damit ist gemeint, dass zumindest ein Angreifer des eigenen Teams die gegnerischen Spieler schon in deren Verteidigungsdrittel unter Druck setzt, sodass diese nicht in Ruhe ihre Aktionen aufbauen können. Wer besonders aggressiv spielen möchte, beordert gar zwei Angreifer nach vorne, um dort für Ärger zu sorgen. Man spekuliert damit, dass die Spieler einen Fehler machen und man schon in der Angriffszone den Puck erhält und vielleicht sogar umgehend ein Tor erzielen kann.
Zumindest aber kann die gegnerische Mannschaft nicht schalten und walten wie sie will und muss mehr Energie aufwenden, um sich zu befreien und einen Angriff aufzubauen. Gerade bei spielerisch nicht so starken Mannschaften kann die Taktik des Forechecking sehr effektiv sein, weil diese sich dann überhaupt nicht mehr befreien können und die spielstarken eigenen Leute das ausnutzen können. So wird die Redewendung von "Angriff ist die beste Verteidigung" Wirklichkeit, indem man die Verteidiger des Gegners unter Druck setzt. Diese wissen, dass ein Fehlpass fatal sein kann und genau deshalb machen sie den Fehler vielleicht auch.
Forechecking im Eishockey
Aber die Geschichte hat natürlich eine zweite Seite, denn man muss aufpassen, dass man nicht in einen Konter läuft. Wenn man zwei der fünf Feldspieler in der Offensive hat, bleiben nur drei Mann übrig, um zu verteidigen. Damit hat die gegnerische Mannschaft viel mehr Platz für Angriffsaktionen und das kann rasch nach hinten losgehen, wenn es sich um Spieler handelt, die sich vom Forechecking nicht beeindrucken lassen. Sie spielen einen langen Pass zum Angreifer und plötzlich ist man selbst in der Defensive und hat zudem zwei Leute weniger für die Verteidigung, weil die erst zurücklaufen müssen.
Daher ist das Forechecking eine Taktik, die gut funktionieren kann, aber nicht muss und man braucht auch die richtigen Leute dafür. Denn diese müssen ständig in Bewegung sein und die Bereitschaft mitbringen, lange Strecken oft zurückzulegen.
Dump'n Chase
(offensive Spielweise)
Dump 'n' Chase in der Eishockey Offensive
Schuss ins Angriffsdrittel als Eröffnung der Offensive
Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um in einem Eishockeyspiel einen Angriff aufzubauen. Der Pass zum Angreifer, der mit dem Puck in das Angriffsdrittel läuft, ist eine häufige Spielweise. Man kann aber auch einen blinden weiten Schuss in das Angriffsdrittel wagen und dies als Einleitung eines Angriffs wählen - man spricht dann vom Dump ´n´ Chase oder Dump & Chase.
Was ist Dump & Chase im Eishockeyspiel?
Im deutschsprachigen Raum wird dieser Angriff als Dump & Chase auch als kanadisch bezeichnet, weil dort diese Methode entwickelt wurde. Die Idee ist dabei relativ simpel. Man spielt den Puck tief in die Angriffszone und die Angreifer laufen dem Puck hinterher, um in einer der Rundungen diesen unter Kontrolle zu bringen, womit man sich auf Höhe des Tors samt Spielgerät einfinden konnte. Nun muss mit einem Pass zum Mitspieler eine gefährliche Aktion daraus entstehen. Die gegnerische Mannschaft ist somit unter Druck und muss versuchen, den Spieler zu entschärfen und noch besser den Puck unter Kontrolle zu bringen.
In vielen Spielsituationen kann man diese Angriffsvariante beobachten, bei der es keinen genauen Pass braucht, um den Mitspieler zu erreichen. Die Verteidiger achten sehr genau darauf, dass die Angreifer nicht anspielbar sind, aber gegen einen Schuss in das Angriffsdrittel aus Sicht der angreifenden Mannschaft kann man wenig machen. Natürlich kann man selbst auch schnell zurücklaufen, um den Puck früher zu erreichen, aber da man die Idee oft erst als zweiter erkennt, ist man meist ins Hintertreffen geraten und muss den weiteren Verlauf des Angriffes unterbinden.
Vorteile dieser Aktion
Die Tatsache, dass man mit der langen Vorgabe den Puck im Angriffsdrittel hat, ist natürlich noch keine Garantie, dass man auch einen Torerfolg wird feiern können, aber man verlagert damit das Spiel in die Offensive und zwingt dem Gegner sein eigenes Spiel auf, sodass dieser nicht in den Angriff übergehen kann.
Ein wesentlicher Vorteil ist die Flexibilität, denn man spielt nicht genau zum Mitspieler und kann damit ungenauer agieren und man kann auch eine Angriffssituation einleiten, obwohl alle Mitspieler gedeckt sind und wenig Möglichkeiten bestehen. Daher wird diese Aktion mit dem Schuss ins tiefe Angriffsdrittel auch sehr oft in Europa angewandt, wohl auch, weil viele kanadische Spieler diese Technik mitgebracht haben.
Penalty und dem Penaltyschiessen
(auch Penaltyschhiessen)
Penalty und Penaltyschiessen im Eishockey
Strafschuss oder Entscheidungshilfe
Wenn in einer Mannschaftssportart eine klare Torchance vereitelt wurde, wird dies zum Teil mit Strafzeiten und Karten geahndet, aber es gibt auch die sportliche Bestrafung durch einen Strafstoß. Der Elfmeter im Fußballspiel ist so eine Möglichkeit, der Siebenmeter wird im Handball gewählt, der Freiwurf im Basketball. Im Eishockeyspiel gibt es die Lösung auch, und zwar im Sinne des Penalty.
Was ist der Penalty iim Eishockeyspiel?
Wenn ein Spieler von Team A fast alleine auf das Tor von Team B stürmt und eine klare Torchance nutzen will und es nicht dazu kommt, weil doch noch ein Verteidiger von Team B diesen Angreifer zu Fall bringen kann, dann wurde eine klare Torchance auf unfaire Art und Weise verhindert und es gibt einen Penalty.
Das bedeutet, dass der gefoulte Spieler losgelöst von allen anderen Spielern einen Torschuss anbringen kann. Umgesetzt wird dies so, dass der Puck auf der Mittelauflage liegt und der Spieler mit Schwung von der anderen Spielseite heranfährt, den Puck mit dem Schläger führt und direkt zum Tor zieht. Bei hohem Tempo sucht er sich eine Ecke aus, um den Torhüter zu überspielen, der zwar groß und das Tor klein ist, aber der Puck wird mit Wucht gespielt und es gibt keine Verteidiger, die den Schuss verhindern oder ablenken könnten. Es ist also eine Situation von Mann gegen Mann - Angreifer gegen Torhüter.
Tatsächlich ist der Torhüter in einer starken Position, weil er häufig den Puck abwehren kann. Er muss sich nur auf diesen Spieler konzentrieren, macht sich vor dem Tor groß und spreizt die Beine, weshalb der Torerfolg nicht so oft gelingen kann wie etwa im Fußballspiel der Torerfolg bei Elfmeter. Meist ist man erfolgreich, wenn man den Puck heben und in die oberen Bereiche des Tors schießen kann, weil mit einem flachen Schuss rechnet der Torhüter. Ist die Aktion vorbei, wird das Spiel normal fortgesetzt.
Penaltyschiessen
Es gibt aber auch abseits von Strafen den Penalty, und zwar in der ähnlichen Form wie das Elfmeterschießen im Fußballspiel - als Entscheidung nach einer Verlängerung. In dem Fall werden drei Spieler genannt, die pro Team antreten müssen, um ihren Penalty zu schießen. Die Torhüter wechseln wie die Spieler ihrer Mannschaften, sodass Spieler 1 von Team A zuerst antritt und sich mit dem Torhüter von Team B misst, dann Spieler 1 von Team B gegen den Torhüter von Team A - bis es zur Entscheidung kommt und ein Spieler den entscheidenden Penalty als Tor verwerten konnte - damit ist das Spiel für seine Mannschaft entschieden.
Das Penaltyschießen ist häufiger eingesetzt, weil es auch in Meisterschaftsspielen kein Unentschieden gibt. Nach der regulären Spielzeit gibt es eine Verlängerung und wenn diese keine Entscheidung bringt, gibt es das Penaltyschießen. Gleiches gilt natürlich auch für die Spiele bei Turniere, wie etwa bei der Eishockey-Weltmeisterschaft.
Empty Net Goal
(iins leere Torr schiessen)
Empty Net Goal im Eishockeyspiel
Schuss ins leere Tor
Im Eishockeyspiel hat man die Möglichkeit, einen Feldspieler mehr auf das Eis zu bringen, wenn man dafür auf den Torhüter verzichtet. Das ist ein riskantes Spiel, weil man beim Eishockey leicht den Puck an den Gegner verlieren kann, aber umgekehrt bietet es auch die Möglichkeit, mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Bekommt der aber den Puck und schießt in das leere Tor, dann hat es ein Empty Net Goal gegeben.
Was ist ein Empty Net Goal?
Das Empty Net Goal ist ein Tor, das man dadurch erzielen kann, weil der Gegner auf seinen Torhüter verzichtet hat. Der typische Fall im Eishockeysport ist dann gegeben, wenn eine Mannschaft mit 3:4 wenige Minuten vor dem Spielende in Rückstand liegt und nach einer kurzen Besprechung mit dem Trainer beschließt, den Torhüter draußen zu lassen. Das heißt, er verlässt die Eisfläche und nimmt auf der Reservebank Platz, dafür spielt ein weiterer Angreifer und man ist mit normalerweise sechs statt fünf Spielern im Einsatz. Das eigene Tor ist damit aber leer. Gelingt es nun dem Gegner den Puck zu erobern und schießt ins leere Tor, dann hat man ein Empty Net Goal erzielt, das im Spielbericht meist als EN abgekürzt wird für Empty Net (Leeres Tor).
Gerade am Ende eines Spiels ist diese Situation häufig anzutreffen, wobei es auch die Variante gibt, dass man nicht erst die letzte Minute oder die letzten zwei Minuten den Torhüter vom Eis nimmt, es gab auch schon Situationen mit fünf Minuten vor dem Ende, weil man zwei Tore aufholen musste. Für den Gegner bedeutet das einerseits mehr Druck in der Abwehr, weil es noch mehr Angreifer gibt, aber andererseits eine riesige Chance. Gelingt nämlich der Treffer ins leere Tor, dann hat sich die Geschichte erledigt und man hat das Spiel fix gewonnen.
Daher ist das Empty Net Goal keine offensive Geschichte der Angreifer, sondern eine defensive aus der Not heraus, weil man unter Druck gesetzt wird. Und so kommt es, dass man zwar unter Druck steht, aber gleichzeitig das Spiel offensiv entscheiden kann. Und die angreifende Mannschaft weiß, dass sie keinen Fehler machen darf.
Ist das Empty Net Goal immer möglich?
Nein, das ist es nicht. Angenommen, im zweiten Drittel wird eine Strafe ausgesprochen, weil von Team A ein Spieler den Gegenspieler von Team B regelwidrig zu Fall gebracht hat. Team B hat aber den Puck und spielt die Aktion weiter. In dem Fall kann Team B den Torhüter herausnehmen und mit einem Spieler mehr agieren, weil es kein Risiko gibt. Wenn nämlich ein Spieler von Team A den Puck erreicht, pfeift der Schiedsrichter sofort ab und die Strafe wird ausgesprochen. Das heißt, Team A hat keine Möglichkeit, ein Empty Net Goal zu schießen, das Risiko ist daher keines, obwohl auch das eigene Tor leer ist.
































